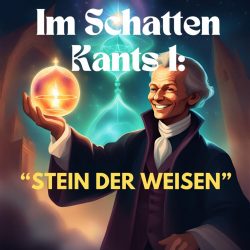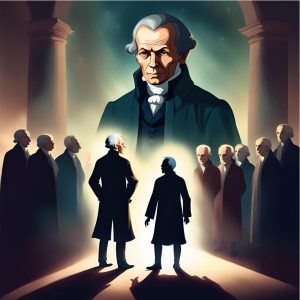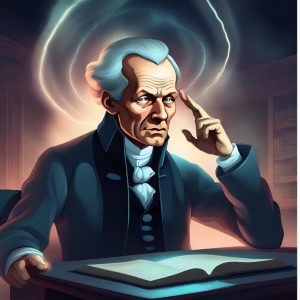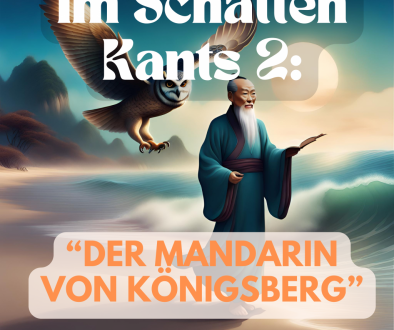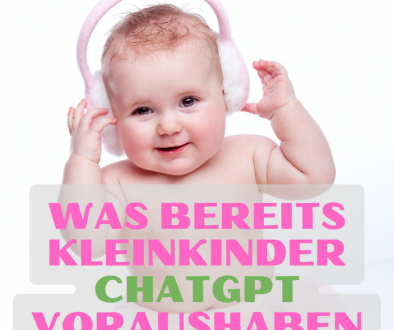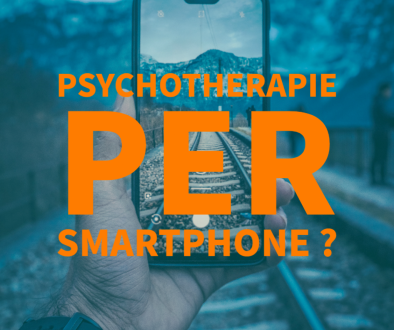Im Schatten Kants 1: Der Stein der Weisen
Immanuel Kant und der Stein der Weisen
„Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen.“
Hermann Cohen, Kants Theorie der Erfahrung, Berlin 1885, Seite XIV (1)
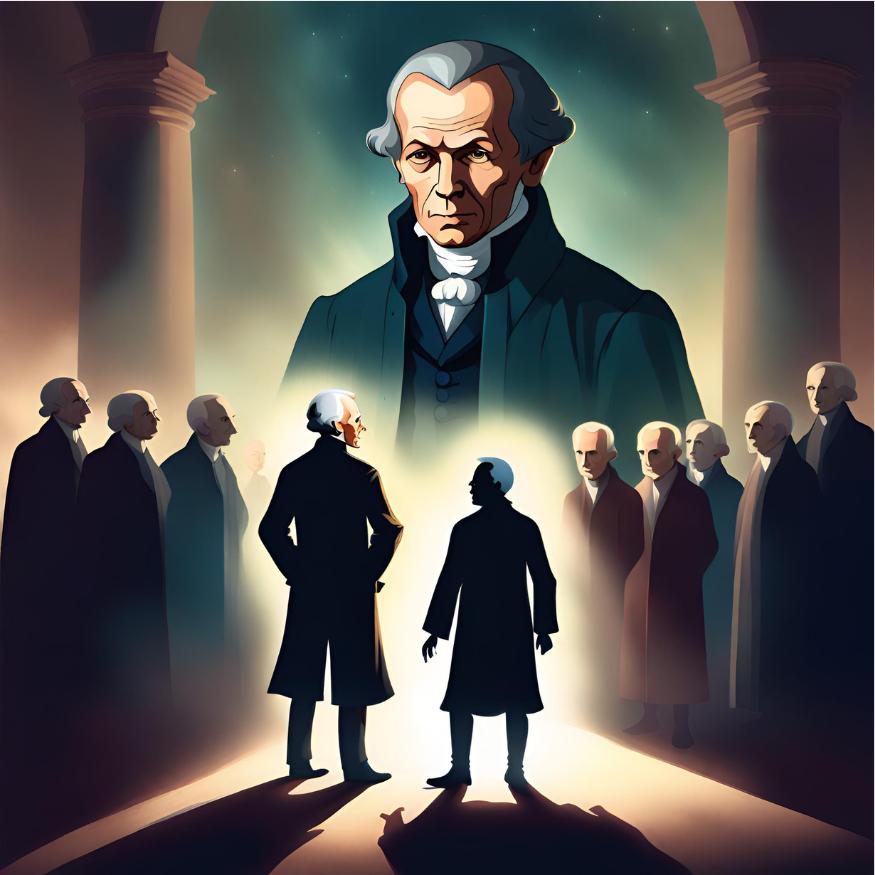
Der gebrochene Damm
Lange habe ich hin- und herüberlegt, ob ich mich daran beteilige:
Immanuel Kant, der philosophische Autor, mit dessen Werken ich mich irgendwann intensiv beschäftigen musste, wird in diesem Jahr anlässlich seiner Geburt vor 300 Jahren – am 22. April 1724 – „Auflagen-erheischend“ gefeiert: Die Welle von Buch-Publikationen, Magazin-Sonderausgaben und Feuilleton-Artikeln in deutschen Zeitungen steigt kontinuierlich an und „ersäuft“ zunehmend das Interesse am Thema.
Doch nachdem ich in den letzten Tagen sehen musste, wie dem Königsberger allerlei „Weithergeholtes“ angedichtet wird, etwa mit seiner spätaufklärerischem Philosophie begänne „die Moderne“, es enthielte die wesentlichen Lösungen für aktuelle politische Krisen und ein gewisser Pegelhöchststand: sein Werk enthalte Hilfe gegen unsere Depressionen anlässlich schwerer Zeiten, brach für mich ein Damm.

Bevor in den nächsten Tagen jemand behauptet, Kants Kritiken bekämpften Hämorriden, Warzen oder Liebeskummer, schreibe ich geschwind etwas – auch wenn es kaum leichtgewichtig genug ist, um oben auf der Publikations-Welle zu „surfen“.
Warum ich mich provozieren lasse? Meinem Entschluss liegt eine persönliche Verpflichtetheit zu Grunde. Zwar hatte sich bei beim weit zurückliegenden Soziologie-, Psychologie- und Philosophie-Studium eher durch Zufall die Chance ergeben, die Argumentation in Kants Kritiken „herauszupräparieren“ und daran anknüpfend wissenschaftstheoretisches Know-how aufzubauen. Aber dieses „Kantwissen“ verhalf mir nacheinander zu einer gelungenen Hauptseminararbeit, zu einer Magister-Arbeit, einer Dissertation, zu bestandenen mündlichen Prüfungen sowie zu einem insgesamt zügigen Studienabschluss.
Dem Denker aus der heutigen russischen Exklave Kaliningrad bin ich also verpflichtet, auch wenn ich dem zustimme, was Heinrich Heine schrieb und eine faktenbasierte Diskussion des kritischen Werks so schwierig macht: „Die Lebensgeschichte des Immanuel Kant ist schwer zu beschreiben. Denn er hatte weder Leben noch Geschichte.“ (2)
Am Ende sind wir alle Kantianer!
Obwohl Kants Person, wie Heine andeutet, eine gewisse „Unscheinbarkeit“ anhaftet, ist „unser Geburtstagskind“ seit vielen Jahrzehnten zu einem historischen öffentlichen „deutschen Intellektuellen“ stilisiert und durch kulturelle Bewertung auf eine hohe, eine Spitzen-Position versetzt worden.

Bildungsbürger identifizieren sich in unserem Land mit Philosophie als einer gleichermaßen nationalen wie kosmopolitischen Domäne. Und ausgerechnet „unser Kant“ bekommt hier die beherrschende intellektuelle Führungsrolle zugebilligt – alles Denken vor und nach ihm stehe in seinem Schatten oder sei ihm zumindest verpflichtet.
Das hört sich übertrieben an, trifft die Sache aber dennoch: Beispielsweise Heidegger schrieb ein komplettes Buch mit seiner Interpretation von Details der transzendentalen Deduktion in Kants Vernunftkritik. Adorno hielt eine kürzlich bei Suhrkamp veröffentlichte vollständige Vorlesung über Kants erste Kritik, diskutierte ausgiebig in seinem Hauptwerk „Negative Dialektik“ Kants Konzept des „intelligiblen Charakters“. Adornos einstiger Assistent Habermas erwähnt in seinem Alterswerk, einer zweibändigen „Art Geschichte der Philosophie“ auf ca. 1.600 Seiten Kant 717 mal (Hegel kommt nur auf 645, Marx gerade einmal auf 264, Schelling – über den der Denker aus dem Bergischen promovierte – nur auf 34, Holbach – einer der einflussreichsten Autoren der europäischen Aufklärung – auf 3 recht kurze Erwähnungen).
Übrigens: Hannah Arendt, deren Vorfahren aus der „Kant-Stadt“ Königsberg stammten, studierte die Kritik der reinen Vernunft, die auf dem Buchregal der Eltern stand, bereits als Jugendliche.
Wer Deutschland als ausgesprochene Kulturnation schätzen und seinen Vertretern gerecht werden möchte, kommt an Kant nicht vorbei. – So hieß es in Wladimir Putins Rede vor dem Deutschen Bundestag am 25. September 2001 einschmeichlerisch und unter Beifall der Anwesenden: „Heute erlaube ich mir die Kühnheit, einen großen Teil meiner Ansprache in der Sprache von Goethe, Schiller und Kant, in der deutschen Sprache, zu halten.“ – (Nicht vergessen: Die genannten beiden bekanntesten deutschen Dichter waren als Verehrer insbesondere der Kritik der Urteilskraft so etwas wie Kant-Schüler …)
„Öffentliche“ Philosophien tendieren dazu, öffentliche Legenden zu werden.
Jetzt kommen wir zu den Folgen, die solche überwältigende öffentliche Würdigung für die Diskussion eines philosophischen Werks und seines Urhebers hat. – Frage: Wie wird die Sicht auf den Autoren der betreffenden Philosophie verändert? Kann seine Philosophie diese Öffentlichkeitswirkung überstehen?
Denn: Ein breites Publikum verbindet mit einer „bekannten“ Philosophie die Vorstellung von einem „konsumierbaren“ Kulturgut, das ein Weltbild und einen „originellen“ Deutungsansatz zur Betrachtung der menschlichen Existenz liefern soll.
Im Einzelnen ist für die Nachvollziehbarkeit der jeweiligen öffentlich beachteten Philosophie wesentlich, dass das dahintersteckende Denk-Konzept sich in die verbreiteten Denk-Traditionen der betroffenen Bevölkerungsgruppe einfügt und in diesem Rahmen – in diesem „Frame“ – Sinn ergibt.

Der Sinn kann darin bestehen, dass die betreffende Philosophie Antworten zu vertrauten Lebensfragen gibt. Dadurch soll es Erklärungen für existentielle Fragen liefern – etwa nach dem Ursprung des menschlichen Lebens, nach ethischen Begründungen umstrittenen Verhaltens usw. – und alternative Haltungen gegenüber verbreiteten Lebenskonzepten entwerfen.
Nun wird es problematisch: Wird eine Philosophie als Sinnvermittlungs-Ressource betrachtet, zeigt sich mehr oder weniger deutlich, dass es erfahrungsgemäß keineswegs werkgetreue Konzepte aus den Original-Werken sind, die in der Diskussion des Publikums eine Rolle spielen.
Stattdessen werden die Namen von Philosophien und Namen von deren Urhebern sowie ausgewählte Begriffe aus dem jeweiligen Werk herausgegriffen und umfassend mit werkfremden Vorstellungen und Ideen in Verbindung gebracht. Öffentliche philosophische Kulturgüter sind Bildungs-Inhalte, die als argumentative Schablonen – als „mindware“ – dienen, als Träger für eigene Gedanken oder eigene Emotionen oder als argumentative Ressourcen, deren Überzeugungskraft für eigene Gedankengänge »ausgeliehen« werden.
Für genau diesen Vorgang ist das Werk unseres Geburtstagskinds – dabei insbesondere seine Kritik der reinen Vernunft (3) – ein anschauliches und gut belegtes Beispiel.
„Alle Erkenntnis ist unsicher!“
Für die breite Öffentlichkeit werden seit langem aus dem verwinkelten Konzept der Vernunftkritik allerlei simple Botschaften abgeleitet.
getAbstract ist ein Online-gestützter Dienst, der Bücher populär und publik macht, indem er zu Fachbüchern nach einem einheitlichen Raster Abstracts – Zusammenfassungen – veröffentlicht.
Auch an Kants Werk hat sich getAbstract „versucht“ – hier findet sich eine Bearbeitung der Kritik der reinen Vernunft, die mit einer Auswahl öffentlich verbreiteter Interpretationen von Kants Argumentation arbeitet (4). Im betreffenden Abstract wird behauptet »Immanuel Kant hat mit der Kritik der reinen Vernunft eine Revolution ausgelöst. (…) Der Königsberger Philosoph untersucht die Grundlagen unserer Erkenntnisfähigkeit und kommt zum Schluss, dass diese begrenzt ist.«
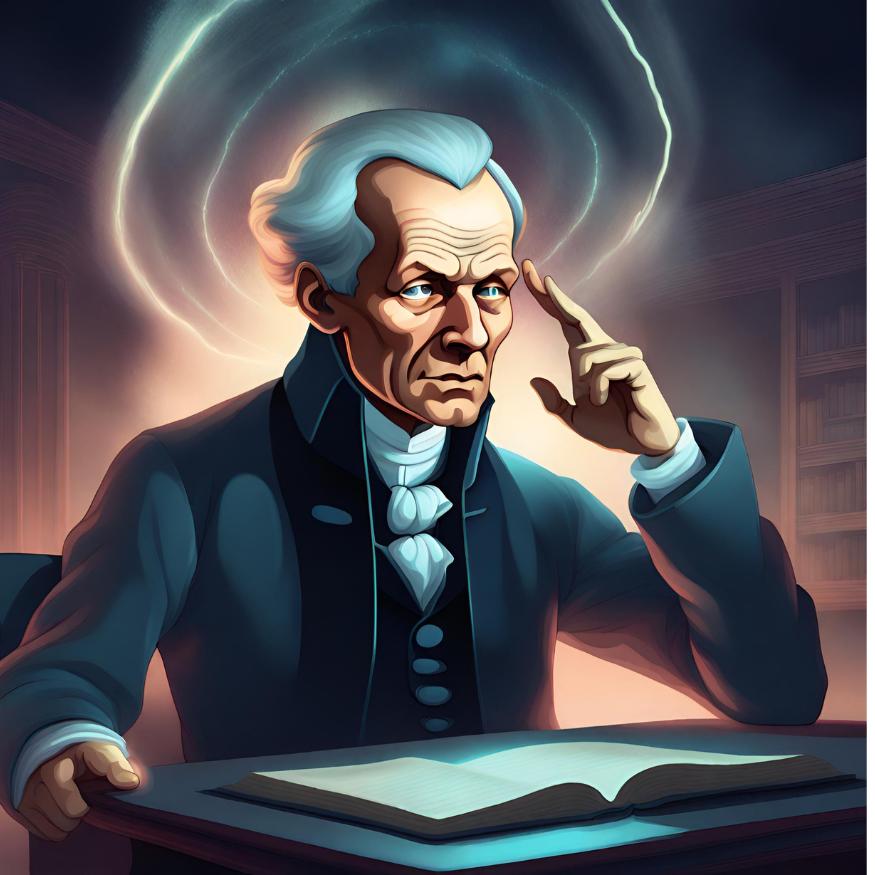
Was ist von dieser Auslegung zu halten? – Da Kant die meiste Zeit seines Lebens in Königsberg gelebt hat, ist es naheliegend, ihn als »Königsberger« Philosophen zu bezeichnen. Der Rest der Deutung von getAbstract – Kant wäre der Vordenker einer Art konstruktivistischer Skeptik an wissenschaftlicher Gewissheit sowie ein Erkenntnis-Bezweifler gewesen – hat kaum etwas mit Kant und dessen Intentionen zu tun.
Ihm ging es stattdessen darum, auf der Basis seiner drei Kritiken die aus seiner Sicht für die menschliche Ethik antinomische – durch Widersprüche bewirkte – Verwirrtheit des Denkens rund um das unverzichtbare Konzept der „Freiheit des Menschen“ endgültig zu beheben.Entsprechend bringt Kant die Intention der Kritik der reinen Vernunft in einem Brief an Christian Garve vom 21.9.1798 auf den Punkt: „ … die Antinomie der r. V.: ‚Die Welt hat einen Anfang – sie hat keinen Anfang etc. bis zur vierten: Es ist Freiheit im Menschen – gegen den: es ist keine Freiheit, sondern alles ist Naturnotwendigkeit‘; diese war es, welche mich aus dem dogmatischen Schlummer zuerst aufweckte und zur Kritik der reinen Vernunft selbst hintrieb, um das Skandal des scheinbaren Widerspruchs der Vernunft mit ihr selbst zu heben.“ (5).
Kant ging es in der Vernunftkritik vor allem um die zweifelsfreie Absicherung von Vernunft-Einsichten. Sein Ziel war Skandal-Bekämpfung und nicht, durch das Säen von Zweifel selbst wiederum ein Skandal-Autor zu werden, wie sich das der von getAbstract beauftragte Autor vorstellt.
„Naturwissenschaftliches Wissen auf ein festes Fundament stellen …“
Eine weitere „folkloristische“ Deutung der Kritik der reinen Vernunft geht in eine vollständig andere Richtung. So ist es populär, zu behaupten, Kants Absicht wäre es in der Vernunftkritik gewesen, durch das berühmte Konzept »synthetischer Sätze a priori« naturwissenschaftliche Empirie und empirische Gesetze zu rechtfertigen und deren Geltung zweifelsfrei zu sichern. Kant-Rezipienten weisen regelmäßig darauf hin, dass es sich hierbei um eine Fehlinterpretation der Kritik handelt (6).
Kant hatte stattdessen versucht, ein Modell unseres „Erkenntnis-Apparates“ zu entwerfen und damit die allgemeinsten „Bedingungen möglicher Erfahrungen“ zu diskutieren. Sein Thema sind Denkvorgänge, die wir heute als „Metakognitionen“ bezeichnen können; die Kritik ist kein Physik-Buch oder gar der Entwurf einer Natur-Philosophie. Die Deutung, Kant hätte in der Kritik einen Weg gesucht und gefunden, empirische Gesetzmäßigkeiten zu begründen und die Newtonsche Naturwissenschaft zu beweisen, klingt beeindruckend – geht aber am Text von Kants Werk vorbei.
Lebenshilfe durch moralischen Kompass – Kant als Schutzpatron
Leserinnen und Lesern wird es nach den letzten beiden Absätzen aufgrund der Nennung von Details der Kritik der reinen Vernunft möglicherweise zunehmend „mulmig“ zu mute. Keine Angst – im Weiteren dieses Beitrags wird es nicht mehr so tief in Werkdetails gehen. Wir wechseln dazu den Fokus und vergegenwärtigen uns, dass es für „öffentliche Philosophien“ typisch ist, Individuen „profunde“ und pragmatisch anwendbare Lebenshilfe zu bieten.

Ein prominentes Beispiel, an dem ablesbar wird, wie das konkret im Zusammenhang mit Kant funktioniert, ist die kurz vor dessen Tod erschienene Autobiografie des ehemaligen Kanzlers und Regierungschefs der Bundesrepublik Deutschland Helmut Schmidt. Dem Altkanzler wurden im Lauf seines Lebens 24 Ehrendoktorwürden beispielsweise der Universitäten von Oxford, von Cambridge, der Sorbonne, der Harvard University und von der Johns Hopkins University verliehen. – Er ist offenbar ein intellektuelles „Schwergewicht“ mit Vorbild-Charakter.
Der spätere Kanzler der Bundesrepublik war als junger Mann während des Dritten Reichs frühzeitig zum Wehrdienst verpflichtet und teilweise zur Ostfront kommandiert gewesen – eine Erfahrung, die er bis zum Lebensende als belastend empfand.
Weiterer Hintergrund – er engagierte sich für kritischen Rationalismus: Im Jahr 1980 lernte er den Philosophen Karl Popper persönlich kennen, dessen „Die Feinde der offenen Gesellschaft“ er zuvor gelesen hatte, und mit dem er bis zu dessen Tod im Jahr 1994 befreundet war.
Schmidt beschreibt in seiner Autobiografie, dass er sich nach dem Krieg der Philosophie Kants zuwandte, um sich insbesondere in Situationen der politischen Unsicherheit neu auszurichten: „In dem moralischen Chaos, das die Nazis hinterlassen hatten, wurde mir Kant zu einem verlässlichen Kompass.“ (Schmidt 2015) Kants Philosophie war Lebenshilfe, indem Schmidt – wie er es konkret beschreibt – einige „Kantische“ Aussagen in seinem Bewusstsein verankerte. So orientierte er sich an dem Satz: „Moralisches Handeln muss auf Vernunft gegründet sein.“, ohne dabei für sich in Anspruch zu nehmen, diese – recht allgemeine – Aussage aus Textstellen in Kants Werk direkt abzuleiten.
Schmidt schätzte diesen Gedanken, weil er ihm nach eigener Einschätzung half, in bewegten Entscheidungs-Situationen innezuhalten und zu überlegten Handlungslösungen zu kommen.
Kein massenmedialer „Stein der Weisen“
Diese Beispiele zeigen, wie die „Rezeption“ eines philosophischen Werks und ihre Verwandlung in eine „öffentliche Philosophie“ genutzt wird, um unterschiedlichste Dinge zu tun. Wie gesehen, wurde in Kants Vernunftkritik eine trendige Skepsis in Bezug auf die vermeintliche Allmacht modernen Wissens „hineingelesen“. Genauso wird mehr oder weniger das genaue Gegenteil bezweckt, wenn behauptet wird, die Vernunftkritik untermauere die Gewissheit empirisch-wissenschaftlicher Gesetze. Und Individuen glauben, bei Kant moralische Regeln zu erkennen, die ihnen als eine Art Verhaltens-Kompass dienen.
Deutlich ist, dass kaum jemand, der aus Kants „öffentlicher Philosophie“ in der einen oder anderen Richtung Nutzen zieht, jemals selbst in der betreffenden Kritik gelesen hat.
Um die Vernunftkritik herum hat sich offenbar eine „öffentliche Legende“ gebildet, die mit dem Inhalt des Originalwerks wenig gemein hat. Das Schicksal dieser Form der Idealisierung teilen mit großer Wahrscheinlichkeit viele philosophische Werke, die breite Aufmerksamkeit erlangen.
Philosophieren funktioniert nicht als massenmedial wirkender „Stein der Weisen“. Die werkgetreue Vermittlung fachlicher Details ist in der Öffentlichkeit angesichts der dafür erforderlichen hohen Expertise höchst unwahrscheinlich. Was im günstigsten Fall von einem öffentlich gemachten philosophischen Werk übrigbleibt, ist ein gewisser positiver Eindruck, der bei Individuen ausgelöst wird und der sie motivieren kann, sich irgendwann einmal ernsthaft mit einem philosophischen Werk auseinanderzusetzen. Ihr Detailstudium könnte ihnen eröffnen, was der jeweilige Autor konkret geschrieben hat. Wenn aufgrund der derzeitigen Geburtstags-Euphorie viele Personen anfangen, sich ernsthaft mit Kant zu beschäftigen, wäre das eine bemerkenswerte und für die akademische Philosophie erfreuliche Wirkung …
Copyrights Bilder
Die Bilder wurden per Künstlicher Intelligenz mit dem Online-Grafik-Service Canva.com erstellt. Im Detail liegen den Darstellungen keine Portrait-Bilder Immanuel Kants zugrunde o.ä. Es handelt sich bei allem um freie AI-„Fantasie“.
Anmerkungen und Quellen
- Hermann Cohen, Kants Theorie der Erfahrung, Berlin 1885 (Ausgabe 2), S. VII
- Heinrich Heine, Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, Vollständiger, durchgesehener Neusatz mit einer Biographie des Autors bearbeitet und eingerichtet von Michael Holzinger, S. 259
- Immanuel Kant (A1781/B1787), Kritik der reinen Vernunft, Hamburg: Meiner Verlag 1976)
- getAbstract, Kritik der reinen Vernunft, Luzern, getAbstract.com 2004
- Immanuel Kant, Briefwechsel, Hamburg: Meiner Verlag 1972 Seiten 779-80
- vgl.
Hoppe, H., Kants Theorie der Physik, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann 1969, S. 7;
Droste, H. W, Die methodologischen Grundlagen der soziologischen Handlungstheorie Talcott Parsons‘, Dissertation, Düsseldorf: Heinrich-Heine-Universität 1985, S. 14 - Helmut Schmidt, Was ich noch sagen wollte, München: Beck-Verlag 2015
Ankündigung:
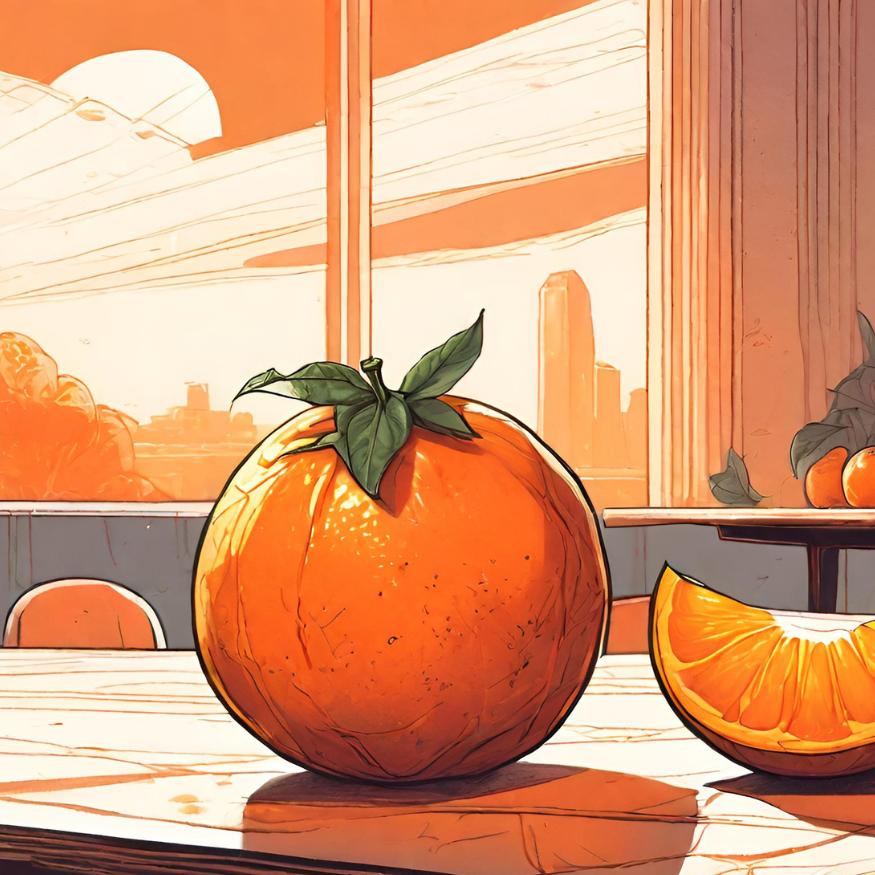
Im Schatten Kants – Teil 2: “Der Mandarin von Königsberg“
Im zweiten Teil meiner Kant-Beiträge im Jubiläumsjahr 2024 zeige ich, wie seine direkten „Nachfolger“ – Fichte, Schelling und Hegel und seine entfernten „Freunde“ – wie Nietzsche, Heine, Habermas – Kants Werk den „Schneid zu nehmen“ versuchten, und was der Königsberger tat, um dem damit einhergehenden „Umbau“ seiner Philosophie zu begegnen …
Englische Version
In the shadow of Kant – Part 1: Immanuel Kant and the philosopher’s stone
„What you have inherited from your fathers, acquire it in order to possess it.“
Hermann Cohen, Kant’s Theory of Experience, Berlin 1885, page XIV (1)
The broken dam
For a long time, I thought back and forth about whether I should take part in this:
Immanuel Kant, the philosophical author whose works I had to deal with intensively at some point, is being celebrated this year on the occasion of his birth 300 years ago – on April 22, 1724 – in a „“edition-raising““ manner: The wave of book publications, magazine special editions and feature articles in German newspapers is steadily rising and increasingly „drowning“ interest in the subject.
But after seeing the Königsberger being credited with all sorts of „far-fetched“ things over the last few days, such as his late Enlightenment philosophy being the beginning of „modernity“, containing the essential solutions to current political crises and a certain peak: his work contains help against our depression on the occasion of difficult times, a dam broke for me.
Before someone claims in the next few days that Kant’s critiques combat haemorrhoids, warts or lovesickness, I’ll quickly write something – even if it’s hardly lightweight enough to „surf“ on top of the publication wave.
Why do I let myself be provoked? My decision is based on a personal obligation. It is true that when I was studying sociology, psychology and philosophy a long time ago, I had the chance, more by chance than anything else, to „dissect“ the argumentation in Kant’s critiques and build up expertise in the theory of science on this basis. But this „Kant knowledge“ helped me to write a successful seminar paper, a master’s thesis, a doctoral dissertation, pass my oral exams and complete my studies quickly overall.
I am therefore indebted to the thinker from today’s Russian exclave of Kaliningrad, even if I agree with what Heinrich Heine wrote, which makes a fact-based discussion of his critical work so difficult: „The life story of Immanuel Kant is difficult to describe. For he had neither life nor history.“ (2)
In the end, we are all Kantians!
Although Kant’s person, as Heine suggests, has a certain „inconspicuousness“, „our birthday boy“ has been stylized for many decades as a historical public „German intellectual“ and has been placed in a high, top position through cultural evaluation.
In our country, „Bildungsbürger“ identify with philosophy as a domain that is both national and cosmopolitan. And „our Kant“ of all people is accorded the dominant intellectual leadership role here – all intellectual thought before and after him stands in his shadow or is at least indebted to him.
This may sound exaggerated, but it is nevertheless true: Heidegger, for example, wrote an entire book with his interpretation of details of the transcendental deduction in Kant’s critique of reason. Adorno gave a complete lecture on Kant’s first critique, recently published by Suhrkamp, and discussed Kant’s concept of the „intelligible character“ at length in his main work „Negative Dialectics“. Adorno’s former assistant Habermas mentions Kant 717 times in his late work, a two-volume “ Kind of History of Philosophy“, which runs to around 1,600 pages (Hegel is only mentioned 645 times, Marx just 264 times, Schelling – on whom the thinker from the Bergisch region did his doctorate – only 34 times, Holbach – one of the most influential authors of the European Enlightenment – only 3 rather brief mentions).
Incidentally, Hannah Arendt, whose ancestors came from the „Kant city“ of Königsberg, studied the Critique of Pure Reason, which was on her parents‘ bookshelf, as a teenager.
Anyone who wants to appreciate Germany as a distinctly cultural nation and do justice to its representatives cannot ignore Kant. – Vladimir Putin’s speech to the German Bundestag on September 25, 2001, for example, was ingratiating and applauded by those present: „Today I allow myself the audacity to give a large part of my speech in the language of Goethe, Schiller and Kant, in the German language.“ – (Don’t forget: As admirers of the Critique of Judgment in particular, the two most famous German poets mentioned were something of Kant disciples …)
„Public“ philosophies tend to become public legends.
Now we come to the consequences that such overwhelming public appreciation has for the discussion of a philosophical work and its author. – Question: How is the view of the author of the philosophy in question changed? Can his philosophy survive this publicity?
After all, a broad public associates a „well-known“ philosophy with the idea of a „consumable“ cultural asset that is supposed to provide a world view and an „original“ approach to interpreting human existence.
In detail, it is essential for the comprehensibility of the respective publicly respected philosophy that the concept of thought behind it fits into the propagated traditions of thought of the population group concerned and makes sense within this framework – in this „frame“.
The significance may lie in the fact that the philosophy in question provides answers to familiar life questions. In this way, it should provide explanations for existential questions – such as the origin of human life, ethical justifications for controversial behavior, etc. – and develop alternative attitudes to propagated concepts of life.
This is where the problem arises: if a philosophy is viewed as a resource for conveying meaning, it becomes more or less clear that experience shows that it is by no means concepts from the original works that play a role in the audience’s discussion.
Instead, the names of philosophies and names of their authors as well as selected terms from the respective work are picked out and comprehensively associated with concepts and ideas that are unrelated to the work. Public philosophical cultural assets are educational contents that serve as argumentative templates – as „mindware“ – as carriers for one’s own thoughts or emotions or as argumentative resources whose persuasive power is „borrowed“ for one’s own trains of thought.
The work of our „birthday boy“ – in particular his Critique of Pure Reason (3) – is a vivid and well-documented example of precisely this process.
„All knowledge is uncertain!“
For the general public, all kinds of simple messages have long been derived from the convoluted concept of the critique of reason.
getAbstract is an online service that popularizes and publicizes books by publishing abstracts – summaries – of specialist books according to a uniform grid.
getAbstract has also „tried its hand“ at Kant’s work – here you will find an adaptation of the Critique of Pure Reason, which works with a selection of publicly disseminated interpretations of Kant’s argumentation (4). The abstract in question claims that „Immanuel Kant triggered a revolution with the Critique of Pure Reason. (…) The Königsberg philosopher examines the foundations of our cognitive faculty and comes to the conclusion that it is limited.
What do we make of this interpretation? – Since Kant lived in Königsberg for most of his life, it makes sense to refer to him as a „Königsberg“ philosopher. The rest of getAbstract’s interpretation – Kant would have been the pioneer of a kind of constructivist skepticism of scientific certainty and a doubter of knowledge – has little to do with Kant and his intentions.
Instead, on the basis of his three critiques, he was concerned with finally resolving what he saw as the antinomic – caused by contradictions – confusion of thought surrounding the indispensable concept of „human freedom“ for human ethics. Accordingly, Kant sums up the intention of the Critique of Pure Reason in a letter to Christian Garve dated September 21, 1798: “ … the antinomy of r. V.: ‚The world has a beginning – it has no beginning etc. up to the fourth: There is freedom in man – against the: there is no freedom, but everything is natural necessity‘; it was this that first awakened me from my dogmatic slumber and drove me to the Critique of Pure Reason itself, in order to lift the scandal of the apparent contradiction of reason with itself.“ (5).
Kant’s critique of reason was primarily concerned with the indubitable validation of the insights of reason. His aim was to combat scandal and not to become a scandal author himself by sowing doubt, as the author commissioned by getAbstract imagines.
„Putting scientific knowledge on a firm foundation …“
Another „folkloristic“ interpretation of the Critique of Pure Reason goes in a completely different direction. It is popular to claim that Kant’s intention in the Critique of Reason was to justify scientific empiricism and empirical laws through the famous concept of „synthetic propositions a priori“ and to secure their validity beyond doubt. Kant critics regularly point out that this is a misinterpretation of the Critique (6).
Instead, Kant had attempted to create a model of our „cognitive apparatus“ and thus to discuss the most general „conditions of possible experience“. His topic is thought processes that we can call „metacognitions“ today; the Critique is not a book on physics or even the outline of a philosophy of nature. The interpretation that Kant sought and found a way to justify empirical laws and prove Newtonian natural science in the Critique sounds impressive – but misses the point of Kant’s work.
Help in life through a moral compass – Kant as patron saint
Readers may feel increasingly „uneasy“ after the last two paragraphs due to the mention of details of the Critique of Pure Reason. Don’t worry – the rest of this article will not go into such great detail. We will change our focus and remind ourselves that it is typical for „public philosophies“ to offer individuals „profound“ and pragmatically applicable help for their lives.
A prominent example of how this works in concrete terms in connection with Kant is the autobiography of former Chancellor and Head of Government of the Federal Republic of Germany Helmut Schmidt, published shortly before his death. Over the course of his life, the former chancellor was awarded 24 honorary doctorates from universities such as Oxford, Cambridge, the Sorbonne, Harvard University and Johns Hopkins University. – He is obviously an intellectual „heavyweight“ with the character of a role model.
As a young man during the Third Reich, the later Chancellor of the Federal Republic of Germany was conscripted into military service at an early age and was sometimes sent to the Eastern Front – an experience that he found stressful until the end of his life.
Further background – he was committed to critical rationalism: in 1980, he met the philosopher Karl Popper in person, whose „The Enemies of the Open Society“ he had previously read and with whom he was friends until his death in 1994.
In his autobiography, Schmidt describes how he turned to Kant’s philosophy after the war in order to realign himself, especially in situations of political uncertainty: „In the moral chaos left behind by the Nazis, Kant became a reliable compass for me.“ (Schmidt 2015) Kant’s philosophy was an aid to life in that Schmidt – as he describes it specifically – anchored some „Kantian“ statements in his consciousness. For example, he was guided by the sentence: „Moral action must be based on reason“, without claiming to derive this – rather general – statement directly from passages in Kant’s work.
Schmidt appreciated this idea because, in his own estimation, it helped him to pause for thought in difficult decision-making situations and come up with considered solutions.
No mass media „philosopher’s stone“
These examples show how the „reception“ of a philosophical work and its transformation into a „public philosophy“ is used to do a wide variety of things. As we have seen, a trendy skepticism regarding the supposed omnipotence of modern knowledge has been „read into“ Kant’s critique of reason. In the same way, more or less the exact opposite is intended when it is claimed that the critique of reason underpins the certainty of empirical-scientific laws. And individuals believe that they can recognize moral rules in Kant that serve as a kind of behavioural compass.
It is clear that hardly anyone who benefits from Kant’s „public philosophy“ in one way or another has ever read the relevant critique themselves.
A „public legend“ has evidently formed around the Critique of Reason, which has little in common with the content of the original work. The fate of this form of idealization is most likely shared by many philosophical works that attract widespread attention.
Philosophy does not function as a mass-media „philosopher’s stone“. The faithful communication of technical details to the public is highly unlikely in view of the high level of expertise required. In the best-case scenario, what remains of a philosophical work that is made public is a certain positive impression that is triggered in individuals and that can motivate them to seriously engage with a philosophical work at some point. Their detailed study could reveal to them what the respective author has actually written. If, as a result of the current birthday euphoria, many people begin to take a serious look at Kant, this would have a remarkable and gratifying effect on academic philosophy …
Copyrighted images
The images were created using artificial intelligence with the online graphics service Canva.com. In detail, the images are not based on portraits of Immanuel Kant or similar. Everything is free AI „fantasy“.
Notes and sources
- Hermann Cohen, Kants Theorie der Erfahrung, Berlin 1885 (Ausgabe 2), S. VII
- Heinrich Heine, Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, Vollständiger, durchgesehener Neusatz mit einer Biographie des Autors bearbeitet und eingerichtet von Michael Holzinger, S. 259
- Immanuel Kant (A1781/B1787), Kritik der reinen Vernunft, Hamburg: Meiner Verlag 1976)
- getAbstract, Kritik der reinen Vernunft, Luzern, getAbstract.com 2004
- Immanuel Kant, Briefwechsel, Hamburg: Meiner Verlag 1972 Seiten 779-80
- vgl. Hoppe, H., Kants Theorie der Physik, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann 1969, S. 7; Droste, H. W, Die methodologischen Grundlagen der soziologischen Handlungstheorie Talcott Parsons‘, Dissertation, Düsseldorf: Heinrich-Heine-Universität 1985, S. 14
- Helmut Schmidt, Was ich noch sagen wollte, München: Beck-Verlag 2015
Announcement:
In Kant’s shadow – Part 2: „The Mandarin of Königsberg“
In the second part of my Kant contributions in the anniversary year 2024, I show how his direct „successors“ – Fichte, Schelling and Hegel and his distant „friends“ – such as Nietzsche, Heine, Habermas – tried to „take the edge off“ Kant’s work, and what the Königsberger did to counter the accompanying „reconstruction“ of his philosophy …