Im Schatten Kants – Teil 2: “Der Mandarin von Königsberg“
„Man kann kein Urtheil über Kant abgeben, ohne in jeder Zeile zu verrathen,
welche Welt man im eigenen Kopfe trägt.“
Hermann Cohen, Kants Theorie der Erfahrung, Berlin 1885, S. VII.
Einleitung
Mit der Episode „Im Schatten Kants 1: Der Stein der Weisen“ starteten wir eine kleine Serie über Immanuel Kants Philosophie. Anlass ist sein dreihundertster Geburtstag – ein bedeutendes Datum für die deutsche Kulturlandschaft:
Denn zum einen identifizieren wir uns hierzulande mit Philosophie als einer gleichermaßen nationalen wie kosmopolitischen Domäne. Viele unserer Intellektuellen nahmen in der Vergangenheit für sich in Anspruch, durch die deutsche Sprache besonders qualifiziert zu sein, philosophisch zu „brillieren“.
Zum anderen billigen wir dabei „unserem Kant“ die beherrschende intellektuelle Führungsrolle zu – alles Denken und Philosophieren vor und nach ihm stehe in seinem Schatten oder sei ihm zumindest verpflichtet.
In der ersten Episode ging es vor allem um die Wirkung des Königsbergers auf typische Bildungsbeflissene unter unseren Mitmenschen – die beispielsweise donnerstags am Kiosk die aktuelle Ausgabe von „Die Zeit“ kaufen (bzw. die Online-Version auf ihr Tablet herunterladen) und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Sendungen wie das literarische Quartett verfolgen …
Wir haben gesehen, wie hochangesehen Immanuel Kant bei diesen literarisch interessierten Personen ist und wie groß das Interesse an seinem Werk und an seinem Denken.
Wir haben ebenfalls in der ersten Episode gesehen, wie groß deshalb die Anstrengung von journalistischen Autorinnen und Autoren etwa im Feuilleton-Bereich von Medien ist, der Konsumentenschaft etwas „Kantianisches“ zu liefern.
Anhand einiger Beispiele haben wir verbreitete Strategien betrachtet, die hierbei genutzt werden, um etwas philosophisch Anmutendes zu erzählen. Die Analyse zeigte, dass Leserinnen und Leser auf dieser Basis „leichtgewichtig“ unterhalten werden.
Allerdings: Mit dem, was Kant geschrieben und beabsichtigt hatte, etwa bei der Konzeption seiner Kritiken, damit hat der verbreitete mediale Inhalt kaum etwas zu tun.

(So stellt sich KI den Typus Kantianischer Leuchttürme vor.)
Was mag dieser eigentliche Kantische Content und sein Konzept gewesen sein und wie werden wir in der öffentlichen Diskussion immer wieder hiervon abgelenkt? Mit diesen Fragen sind wir auf der Spur für den Gedankengang der auf den ersten Kant-Podcast folgenden Episoden. Wir betrachten anhand einiger herausragender historischer deutscher Intellektueller ein typisches Muster des Umgangs mit Kants Werk. Es handelt sich um eine Art „Erst Küssen und dann Schlagen“-Taktik, die folgendermaßen funktioniert: Autoren greifen Kants Kritiken auf, loben diese sozusagen als Leuchttürme philosophischen Bemühens, um diese dann rasch umzuwerfen und deren Fundament einzuplanieren, um darauf einen eigenen „Sprung“ in vermeintlich neue „intellektuelle Dimensionen“ auszuführen.
„Der verwachsenste Begriffskrüppel aller Zeiten“
Der erste Leuchtturm-Mythos, den wir uns ansehen, ist die These, Kants kritisches Werk wäre die modellhafte Verkörperung der Brillanz, die typisch ist für philosophische Autoren deutscher Sprache.
Der historische Intellektuelle, der Kant in zwei Schritten von diesem Brillanz-Thron besonders rücksichtslos herunterholt, ist der ehemalige Professor der Altphilologie Friedrich Nietzsche.

(So stellt sich KI den mit dem Hammer philosophierenden Friedrich Nietzsche vor.)
Dieser wendete sich gegen die Charakterisierung von Immanuel Kant als allgemein hochgeschätztem Intellektuellen, als unserem deutschen „National-Philosophen“ mit herausragender Ausdrucksmöglichkeit und Reflektionsfähigkeit – kurz: der Verkörperung dessen, was deutsche Philosophie auf höchstem Denkniveau vermag.
In seinen Schriften bezieht sich Nietzsche immer wieder zunächst positiv und voller Achtung auf den „alten Kant“. Doch im Jahre 1889 in „Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert.“ lässt ein wütender Friedrich seinen aphoristischen Hammer im Kapitel „Was den Deutschen abgeht“ (1) laut scheppernd herunterkrachen. Dabei argumentiert er im Detail folgendermaßen:
Er lamentiert zunächst darüber, dass seine deutschen Mitmenschen nicht mehr richtig Denken lernen. Er vermisse formale Versiertheit, Technik, Willen zur Meisterschaft sowie eine vornehme Eleganz, die etwas „Tänzerisches“ haben sollte:
„Denken lernen: man hat auf unsern Schulen keinen Begriff mehr davon. Selbst auf den Universitäten, sogar unter den eigentlichen Gelehrten der Philosophie beginnt Logik als Theorie, als Praktik, als Handwerk, auszusterben. Man lese deutsche Bücher: nicht mehr die entfernteste Erinnerung daran, daß es zum Denken einer Technik, eines Lehrplans, eines Willens zur Meisterschaft bedarf – daß Denken gelernt sein will, wie Tanzen gelernt sein will, als eine Art Tanzen (…)“
Das „Wesen“ des Tanzens gehört für Nietzsche zur Vornehmheit, die in Deutschland nicht gepflegt wird, ebenso wie das elegante Schreiben, das seine Mitmenschen ebenfalls für ihn offenkundig nicht mehr beherrschen:
Statt der Eleganz und der intellektuellen Feinheit erkennt der wütende Nietzsche nur noch „die steife Tölpelei der geistigen Gebärde“. An dieser Stelle nimmt er eine über den deutschen nationalen Fokus hinaussteigende Perspektive ein und behauptet: Aus der Sicht ausländischer Betrachter ist diese Steifheit das herausragende, typische Merkmal deutscher kultureller Äußerung – es fehle an Nuancen des Ausdrucks. Und nun kommt der Schlag auf Kants Werk, wenn Nietzsche behauptet, der Mangel an nuancenreichem Ausdruck offenbare sich daran, dass sie „ (…) die Deutschen ihre Philosophen auch nur ausgehalten haben, vor allem jenen verwachsensten Begriffs-Krüppel, den es je gegeben hat, den großen Kant“.

(So stellt sich KI den tanzenden Nietzsche vor.)
Für Nietzsche ist Kant also nicht mehr die Verkörperung philosophischer Brillanz, sondern als der „verwachsenste Begriffskrüppel, den es je gegeben hat“ ein Symbol einer „steifen Tölpelei“. An anderer Stelle – in „Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft“ tituliert er Kant als „den großen Chinesen“ (2) also als Mandarin von Königsberg. Offenbar verwarf Nietzsche mit Blick auf die philosophische Zukunft das Kantische Erbe und sah es als symptomatisch für einen Niedergang in Parallele zum Abstieg des damaligen Chinas und dem einst bedeutenden Mandarinentum. – Mandarine waren elitäre Gelehrte und Beamte in allen Bereichen der chinesischen Verwaltung. – Es deutet sich an, dass Nietzsche das deutsche Gelehrtentum seiner Zeit, als „Klasse“ wahrnahm, deren geistig-intellektuelle Qualität verfiel und mit Blick auf die kulturelle Entwicklung außerhalb Deutschlands nicht konkurrenzfähig war.

(So stellt sich KI einen in den Mandarinen verwandelten Kant und dessen Eule der Weisheit vor.)
„Ungewöhnliche Form und schlechte Schreibart“
Mit Nietzsche sehen wir also den ersten Leuchtturm-Mythos angegriffen, Kant sei ein Muster philosophischer Brillanz. Ein zweiter Leuchtturm-Mythos, der unmittelbar an die Brillanz anknüpft, ist die Beurteilung, Kants sprachliche Kraft sei bemerkenswert – sie zeichne sich durch Klarheit, Präzision und eine einprägsame Argumentation aus. Sein Schreibstil habe die Ausdrucksmöglichkeit der deutschen Sprache bereichert und viele seiner Begrifflichkeiten und Wendungen seien heute noch gebräuchlich.

(Heinrich Heine – brillanter Autor deutscher Sprache: So sieht ihn die KI.)
Zu diesem Thema folgen wir nun der Analyse Heinrich Heines, 1797 in Düsseldorf geborener, bedeutender Autor des 19. Jahrhunderts. Von ihm wird heute gesagt, er habe die Alltagssprache lyrikfähig gemacht und der deutschen Literatur eine zuvor nicht gekannte, elegante Leichtigkeit verliehen. In Deutschland war er als kritischer Journalist, Satiriker und Polemiker bewundert und offenbar noch mehr gefürchtet, wurde mit Publikationsverboten belegt und ins Pariser Exil gezwungen. Während er im Laufe der Zeit posthum im Ausland große Anerkennung – etwa in Spanien, Frankreich, England, den USA, in Osteuropa und Asien – erreichte, tut sich die deutsche Öffentlichkeit bis in die Gegenwart schwer mit diesem größten Kulturträger, den Düsseldorf bisher hervorgebracht hat: 23 Jahre dauerte ein Streit um die Namensgebung, um schließlich die Düsseldorfer Universität wie ursprünglich geplant, im Jahr 1988 „Heinrich-Heine-Universität“ zu nennen.
Heine – ein Experte verständlicher und eleganter deutscher Sprache – hat sich ausführlich mit Kants Schriften und deren Wirkung beschäftigt. Dazu schauen wir in seinen 1834 entstandenen Titel „De l’Allemagne depuis Luther“ („Über Deutschland seit Luther“) (3).
Auch bei Heinrich Heine finden wir das Muster des anfänglichen Verbeugens vor Kant und seinem „großen Buch“:
„Die ‚Kritik der reinen Vernunft‘ ist das Hauptwerk von Kant, und wir müssen uns vorzugsweise damit beschäftigen. Keine von allen Schriften Kants hat größere Wichtigkeit.“ Im nächsten Schritt verweist er darauf, dass dieses Buch, schon im Jahr 1781 erschien, aber erst 1789 allgemein bekannt wurde. Es wurde anfangs beinahe vollständig ignoriert. Erst als es anderen Autoren gefiel, die Kritik als Grundlage für eigene publizistische Ziele zu nutzen, wurde es einem breiten Publikum bekannt gemacht. Heine erklärt die „intellektuelle Schwerverdaulichkeit“ der Vernunftkritik mit Kants schlechtem Schreibstil und tadelt den Königsberger für diese Schwäche scharf: „Die Ursache dieser verzögerten Anerkenntnis liegt wohl in der ungewöhnlichen Form und schlechten Schreibart. In betreff der letztern verdient Kant größeren Tadel als irgendein anderer Philosoph; (…)“
Heine stellt die Frage: „Warum aber hat Kant seine »Kritik der reinen Vernunft« in einem so grauen, trocknen Packpapierstil geschrieben?“ Der Düsseldorfer Exilant beantwortet diese Frage, indem er vermutet, Immanuel Kant habe zwar einen bedeutenden Gedankengang entwickelt, sei aber daran gescheitert, eine angemessene neue Sprache dafür zu entwickeln, denn: Kant wäre kein Genie gewesen:
„(…) vielleicht bedurfte Kant zu seinem sorgfältig gemessenen Ideengang auch einer Sprache, die sorgfältig gemessener, und er war nicht imstande, eine bessere zu schaffen. Nur das Genie hat für den neuen Gedanken auch das neue Wort. Immanuel Kant war aber kein Genie.“
Heinrich Heine begnügt sich nicht damit, die Sprache in Kants Schriften – insbesondere seines kritischen Werks – drastisch zu kritisieren. Er sieht Kant als Verursacher eines Schadens, der weit darüber hinaus geht. Denn er habe ein Beispiel vorgelegt, das die deutsche Philosophie „nachhaltig“ schädigt. Tatsächlich: Heines Beurteilung wirft ein scharfes Licht auf einen großen Teil, der seither veröffentlichten deutschen Philosophie:
„Kant hat durch den schwerfälligen, steifleinenen Stil seines Hauptwerks sehr vielen Schaden gestiftet. Denn die geistlosen Nachahmer äfften ihn nach in dieser Äußerlichkeit, und es entstand bei uns der Aberglaube, daß man kein Philosoph sei, wenn man gut schriebe.“
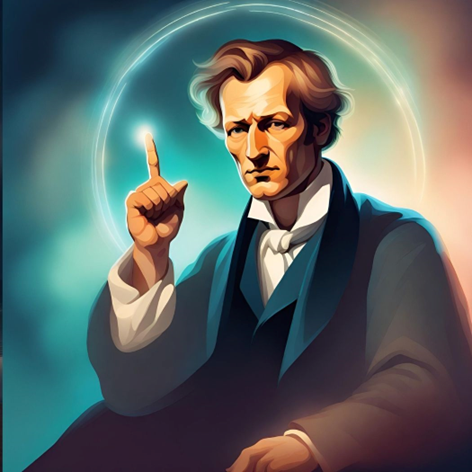
(So sieht es die KI: Heine kritisiert den miserablen Schreibstil deutscher Philosophen.)
„Dieses Nervensaft verzehrende Werk“
Der dritte Leuchttum-Mythos, von dem sich Bildungsbürger verabschieden müssen, ist die Vorstellung, der Autor Kant wäre die Verkörperung dessen, was einen erfolgreichen Verbreiter und Durchsetzer neuer philosophischer Ansätze ausmacht.

(Kant traf irgendwann einmal Moses Mendelssohn persönlich: So stellt sich die KI ihre Begegnung vor.)
Um zu analysieren, wie es um Kants „Propagierungs-Geschick“ bestellt war, schauen wir uns wiederum einen bedeutenden Intellektuellen an, der in Bildungskreisen große Wirkung erzielen konnte. Und zwar handelt es sich um Moses Mendelssohn (1729-1786), der heute als Wegbereiter der jüdischen Aufklärung gilt. Er publizierte umfangreich über aktuelle philosophische Fragen.
Immanuel Kant schätzte Mendelssohn als öffentlichkeitswirksamen Diskussionspartner besonders hoch ein. Moses Mendelssohn gewann im Jahr 1763 gegen ihn bei einem von der Preußischen Königlichen Akademie der Wissenschaft ausgeschriebenen Wettbewerb zu metaphysischen Fragen.
Wenn wir heute in den Briefwechsel Immanuel Kants mit Mendelssohn schauen, können wir rund um die „PR“-Aktivitäten des Königsbergers eine dramatische Geschichte hautnah mitverfolgen (4):
Als die Kritik der reinen Vernunft dabei war zu erscheinen, war sich Kant bewusst, dass zunächst kaum jemand sein Buch lesen und zu verstehen suchen würde (Brief an Marcus Herz vom 11.5.1781: „… auf welche Bemühung ich nur bei sehr wenig Lesern gleich anfangs rechnen darf …“).
In dieser Situation setzte Kant auf die intellektuelle Strahlkraft und die Expertise in Fragen der philosophischen Metaphysik bei Moses Mendelssohn. Er hoffte, an diese per Vermittlung des gemeinsamen Freundes Marcus Herz heranzukommen. Seine Vorstellung war, Mendelssohn würde seine Kritik lesen, analysieren und seine Einschätzungen danach etwa in Form von Veröffentlichungen in die Diskussion gebildeter Kreise hineintragen.
Der Königsberger gab deshalb seinem Verlag Anweisung, Exemplare der Erstausgabe der Kritik „auf feinem Papier als Dedikationsexemplar“ (Brief an Carl Spener vom 1.5.1781), also als Exemplare mit speziell eingebundener Widmungsseite zu produzieren und nach Berlin an Marcus Herz zu schicken. Kant bat Herz eines dieser Sonderexemplare für dessen eigene Lektüre vorzusehen und eines dessen Freund Moses Mendelssohn weiterzureichen und schrieb hierzu: „Sobald ich durch Ihre Mühwaltung von allem diesen Nachricht habe, werde mir die Freiheit nehmen, an Sie Wertester, und HEn, Mendelssohn über diesen Gegenstand etwas mehreres zu schreiben …“ (Brief an Marcus Herz vom 1.5.1781)
Schon 10 Tage später machte ein weiterer Brief von Kant an Herz deutlich, dass es zuvor schlechte Nachrichten gegeben hatte und seine Propagierungs-Strategie zumindest vorläufig gescheitert war: „Daß Herr Mendelssohn mein Buch zur Seite gelegt habe, ist mir sehr unangenehm, aber ich hoffe, daß es nicht auf immer geschehen sein werde.“ (Brief an Marcus Herz vom 11.5.1781)
Leserinnen und Leser fragen nun gespannt: Würde Mendelssohn, einer der prominentesten deutschsprachigen Intellektuellen seiner Zeit, irgendwann doch noch die Kritik in die Hand nehmen und lesen? – Um diese Frage zu beantworten, schauen wir weiter durch den Briefwechsel:
Wie wir bereits aus der Beschreibung von Heinrich Heine wissen, wurde Kants Kritik in den ersten Jahren nach Veröffentlichung vom Fachpublikum ignoriert und erreichte keinerlei Öffentlichkeitswirkung. Entsprechend finden wir in Kants Briefwechsel zunächst keine Korrespondenz mit Moses Mendelssohn. Doch dann – am 10. April 1783, nach beinahe zwei Jahren – sandte Mendelssohn den Brief, der aufklären konnte, warum der Berliner sich bisher nicht zur Vernunftkritik äußern konnte. Mendelssohn beschrieb Kant, dass er über Jahre an einer Einschränkung seiner philosophischen Kompetenz litt: „Seit vielen Jahren bin ich der Metaphysik wie abgestorben. Meine Nervenschwäche verbietet mir alle Anstrengung, und ich amüsiere mich unterdessen mit minder angreifenden Arbeiten (…)“ (Brief Moses Mendelssohn vom 10.4.1783)
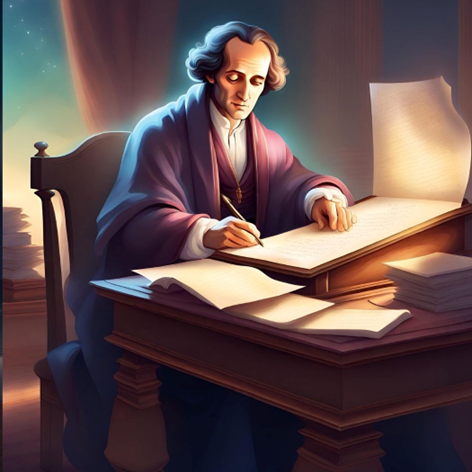
(Mendelssohn schreibt Kant – so sieht es die KI.)
Immanuel Kant war also damit konfrontiert, dass ausgerechnet der hochgeschätzte Intellektuelle „gesundheitlich ausfiel“, der aus seiner Sicht als einziger über die Kompetenz verfügte, die Kritik angemessen in die Diskussion der Fachöffentlichkeit hineinzutragen.
Allerdings: Mendelssohn nährte in seinem Brief – wenn auch schwach und vielleicht nur höflichkeitshalber – die Hoffnung, er könne irgendwann ausreichend gesunden, um sich der Kritik zu stellen:
„Ihre Kritik der reinen Vernunft ist für mich auch ein Kriterium der Gesundheit. So oft ich mich schmeichele an Kräften zugenommen zu haben, wage ich mich an dieses Nervensaft verzehrende Werk, und ich bin nicht ganz ohne Hoffnung, es in diesem Leben noch ganz durchdenken zu können.“
Möglicherweise war es diese Andeutung, es gäbe noch eine gewisse Hoffnung, Mendelssohn könnte sich doch noch zur Lektüre „aufraffen“ bzw. könnte durch Hilfestellung zur Diskussion der Kritik motiviert werden, die Kant am 16. August 1783 veranlasste, den Berliner anzuschreiben.
Seinen Brief startet Kant versöhnlich, indem er betont, Mendelssohns „Nervenschwächen“-Probleme durchaus zu verstehen. Aus Kants Sicht war nicht nur Mendelssohn der Metaphysik „abgestorben“. Ihm schien „die ganze klügere Welt abgestorben zu sein“.

(Kant schreibt Mendelssohn – rekonstruiert von der KI.)
Der Königsberger baut nach diesem Einstieg in seinen Brief eine ganze Reihe von Schmeicheleien ein, um den Briefempfänger „gewogen“ zu machen. Dabei zeigt Kant, wie sehr er an Mendelssohns Fähigkeiten der Beeinflussung von Fachdiskussionen interessiert ist.
Schauen wir uns einmal an, wie der Königsberger im Detail schmeichelnd um Unterstützung wirbt:
Kant argumentiert zunächst, die Schwierigkeit der Darstellung der Vernunftkritik läge darin, vorherzusehen, mit welchen Details darin die möglichen Leser Verständnisprobleme haben könnten. Dieses Vorhersehen der Bedenken in der Zielgruppe hielt Kant zum Erreichen von Publizität für entscheidend. Allerdings sah er sich zum Zeitpunkt der Abfassung seines Textes für überfordert, mit dieser Schwierigkeit selber fertig zu werden:
„Denn man kann nicht immer erraten, was für den Leser dunkel ist oder was ihm nicht genügend bestimmt oder bewiesen erscheint (…).“
Kant lobt nun Mendelssohn, hierfür ein außerordentlich großes Talent zu sein: „Es gibt nur wenige, die so glücklich sind, für sich selbst und zugleich für andere denken zu können und die für alle angemessene Art des Vortrags zu treffen. Es gibt nur einen Mendelssohn.“
Neben solchen Schmeicheleien gegenüber seinem Adressaten ist ein weiterer interessanter Zug in Kants Brief, wie er diesen durch besondere Offenheit zu gewinnen versucht. Kant gesteht, bei der Publikation der Kritik ein Risiko eingegangen zu sein, das ihm nun Nachteile bringt. Er hätte über einen Zeitraum von mindestens zwölf Jahren nachgedacht und schließlich die dabei gefundenen Einsichten „innerhalb etwa 4 bis 5 Monaten, gleichsam im Fluge“ „heruntergeschrieben“.Er habe bewusst unter diesen Bedingungen beim Abfassen und Veröffentlichen der Vernunftkritik den Aspekt der „Popularität“ außer Acht gelassen. Das heißt, Kant hatte den Anspruch der Verständlichkeit für Leser zunächst zurückgestellt und „die Förderung der klaren Einsicht beim Leser“ unberücksichtigt gelassen. Kant hielt sich – obwohl er beim Abfassen seiner Kritik „erst“ ca. 56 Jahre alt war – für zu alt, sein komplexes Denksystem auszufeilen und „jedem Teil seine Rundung, Glätte und leichte Lesbarkeit zu geben, während ich die Feile in der Hand halte“.
Kant hatte bei der Veröffentlichung seiner Kritik darauf gesetzt, dass sich nach Veröffentlichung eine Fachdiskussion erheben würde, in dessen Rahmen er Gelegenheit hätte, Schritt für Schritt die Details seines Konzepts verständlich zu erläutern. Er führt Mendelssohn gegenüber aus, sich durchaus im Besitz der notwendigen Argumente und überzeugenden Gedanken zu sehen. Kant glaubte deshalb, den Fehler seiner „unpopulären Schreibart“ zukünftig sicher beheben zu können.

(Mendelssohn scheiterte gesundheitlich an der Kritik der reinen Vernunft – so symbolisiert es die KI.)
Als Voraussetzung sah er, dass im ersten Schritt nun die Diskussion seines Buchs überhaupt erst einmal starten müsste. Der Königsberger zeigte sich ungeduldig und unternahm in seinem Brief einen verzweifelt wirkenden Versuch, Mendelssohn zum Start dieser Diskussion zu bewegen: Kant lieferte eine knappe Zusammenfassung seines Werks, die er in Form einer Darstellung der drei Kernthesen der Kritik formulierte. Er hoffte, Mendelssohn hiermit eine Diskussionsvorlage – heute würden wir sagen: ein Cheat Sheet („einen Fuschzettel“) – an die Hand gegeben zu haben, die dieser für eigene Beiträge nutzen könnte, ohne sich selbst mit der Kritik beschäftigen zu müssen.
Heute wissen wir: Kants Briefinitiative war nicht erfolgreich. Nicht nur, dass sich Moses Mendelssohn von seiner „Nervenschwäche“ bis zu seinem frühen Tod Anfang des Jahres 1786 nicht mehr hatte erholen können. In seinem kurz vorher im Jahr 1785 erschienenen Band „Morgenstunden oder Vorlesungen über das Dasein Gottes“ (5) bestätigte er für die Nachwelt in vollständiger Klarheit, dass er weder die Kritik wie erhofft durchgearbeitet hat, noch die gewünschte Initiative in der Fachdiskussion starten konnte:
„Seit zwölf bis fünfzehn Jahren befinde ich mich nehmlich in dem äußersten Unvermögen, meine Kenntnisse zu erweitern. Eine sogenannte Nervenschwäche, der ich seitdem unterliege, verbietet mir jede Anstrengung des Geistes, und, welches den Aerzten selbst sonderbar vorkömmt, sie erschweret mir das Lesen fremder Gedanken fast noch mehr, als eigenes Nachdenken. (…)“
In Bezug auf Schriften zur philosophischen Metaphysik – dem Themenfeld der Kantischen Kritik – präzisiert er, nur bis zum Jahr 1775 – also bis deutlich vor Erscheinen der Vernunftkritik – der Fachdiskussion gefolgt zu sein:
„(…) Für mich stehet also diese Wissenschaft noch itzt auf dem Punkte, auf welchem sie etwa um das fünf und siebenzigste Jahr dieses Jahrhunderts gestanden hat; (…)“
Kommen wir zu einem Fazit – schauen wir dazu auf die endgültig gescheiterte Hoffnung Kants, Moses Mendelssohn könnte ihn aus der Publizitäts-Verlegenheit rund um seine Kritik befreien:
Immanuel Kant hatte geglaubt, mit der Kritik der reinen Vernunft die Existenz einer für die „Menschheit unentbehrliche Erkenntnis“ aufgedeckt zu haben, auf die „mit der Zeit auch Popularität folgen“ (6) würde. Dass die Erreichung der Popularität der Vernunftkritik eine Herausforderung werden würde, war ihm bereits klar, als die erste Druckauflage erstellt war. Die Probleme mit der Popularisierung der Vernunftkritik waren wesentlich größer, als er diese erwartet hatte, wie wir hier hautnah am Briefwechsel Kants mit seinem Freund Herz und seinem Bekannten Mendelssohn ablesen konnten.
Denn lange Zeit nach Erscheinen gab es keine Buchbesprechung der Kritik, Und die erste, die in den »Göttingischen gelehrten Anzeigen« erschienene sogenannte »Göttinger Rezension«, erwies sich als ein von zwei populär-philosophischen Autoren zusammengestückter Verriss der Kritik der reinen Vernunft. Kant analysierte selbstkritisch, dass das sich in dieser Besprechung zeigende Unverständnis zumindest teilweise „von der Weitläufigkeit des Plans“ seiner Vernunftkritik herrührte (7). Aus diesem Grund investierte Kant in der Folge viel Kraft, um Lesern seine Vernunft-Argumente klarer zu strukturieren.
Beispielsweise verfasste er zu diesem Zweck bereits im Jahr 1783 einen Erläuterungsband zur Vernunftkritik – die sogenannte »Prolegomena«.
Anschließend überarbeitete er die im Jahr 1781 erschienene Erstausgabe („Ausgabe A“) der Kritik umfassend. Die zweite Ausgabe („Ausgabe B“) erschien im Jahr 1787. Und schließlich erweiterte Kant sein kritisches Projekt um zwei weitere Bände, in denen er Teilaspekte der Vernunftkritik separat ausarbeitete – 1788 erschien die Kritik der praktischen Vernunft und 1790 die Kritik der Urteilskraft.
Ob diese Anstrengungen Kants für den Ruhm seiner Vernunftkritik allein Erfolg gehabt hätten, ist zweifelhaft. Stattdessen wurde sein Werk, das wie gesehen selbst wohlwollende Bekannte als „Nervensaft verzehrend“ bezeichneten, erst aufgrund des Eingreifens Dritter zu einem „bedeutenden Werk“.
Das kam so: Kants Buch wurde im Rahmen des damaligen sogenannten »Pantheismusstreit« von dem aus Wien stammenden Ex-Jesuiten Karl Leonard Reinhold strategisch als publizistisches „Werkzeug“ genutzt. Reinhold gehörte zu den Illuminaten, einem Zirkel von Intellektuellen, die sich in der Diskussion der radikalen Ideen der Aufklärung engagierte. Er richtete sich aktiv gegen die damals besonders einflussreichen französischen Aufklärer aus dem Umfeld der Autoren der Encyclopédie – etwa gegen Denis Diderot und den aus Deutschland stammenden Paul Heinrich Dietrich besser bekannt als Baron von Holbach. (8)
Reinhold ging es insbesondere darum, die aus seiner Sicht „skandalösen“ Schlussfolgerungen aus dem in der französischen Aufklärung leidenschaftlich diskutierten „naturalistischen“ Spinozismus und Materialismus zu bannen. Um eine überzeugende Gegenposition zum daraus abgeleiteten Atheismus zu propagieren, schrieb Reinhold in der in Weimar erscheinenden Literaturzeitschrift Der Teutsche Merkur eine Folge von Artikeln „Briefe über die Kantische Philosophie“. Diese Briefe vereinfachten den Inhalt der Kritik stark und deuteten sie in eine reaktionäre „Vernunftbegründung“ christlicher Dogmen und christlicher Ethik um. Erst mit diesen Briefen und auf der Basis einiger anderer publizistischer Interventionen konnten Reinhold und andere Publizisten die Grundlage für den Publizitäts-Durchbruch der Kritik der reinen Vernunft legen und den Einfluss von Kants weiteren Kritiken auf die folgenden Philosophen etwa des Idealismus begründen.

(Erst spät hatte Kants Kritik einen Durchbruch – so symbolisiert es die KI.)
Tatsächlich konnte die Vernunftkritik die Bekanntheit, die sich bis heute in unseren „gebildeten Kreisen“ erhalten hat, nur auf der Basis dieser konservativen Hilfestellung erreichen. Dabei ist besonders bemerkenswert, dass dieser Konservatismus gegen die modernen politisch und weltanschaulich radikaldemokratischen Konzepte der westeuropäischen Aufklärung gerichtet war, die großen Einfluss im Rahmen der amerikanischen und französischen Revolutionen haben sollten.
Als weiterer großer Nachteil dieser eher gegenaufklärerischen Publizität erwies sich bereits zu Kants Lebzeiten, dass er auf diese Weise die Deutungs-Hoheit in Bezug auf seine eigenen Gedanken verloren hatte.
War es unter anderem seine Absicht, spekulatives Denken streng durch empirisches Erfahrungswissen zu begrenzen, verwarfen seine „romantischen“ und idealistischen Nachfolger diese Begrenzung für ihre „absoluten“ Geistes-Konstruktionen und Prophetien – wie es bei Hegel heißt – als „Abscheulichkeit“, die mittels einer „barbarischen“ Begrifflichkeit“ vermittelt wurde. (9)
„Abscheuliche Unterscheidungen und barbarische Begrifflichkeit“
In den vorhergehenden Abschnitten klang schon an, welcher nächster philosophischer Leuchtturm-Mythos bei genauer Betrachtung „einstürzen“ muss:
Im Zusammenhang mit Kants Werk wird in unseren „gebildeten Kreisen“ häufig die Vorstellung von der Souveränität des Königsbergers ausgebreitet: Er habe eine revolutionäre Tradition begründet, die das Denken auf eine neue Ebene anhebt, damit ganze Philosophen-Generationen geprägt und die Ausrichtung ihrer Konzepte auf eine überlegene Vernunft-Spur gesetzt.
Beispielsweise bereits auf der ersten Seite der von Manfred Kühn vorgelegten informativen Kant-Biografie (10) finden wir mit diesem Mythos deutlich kollidierende Hinweise:
Kühn beschreibt, dass Immanuel Kant – als er im Frühjahr 1804 nur wenige Wochen vor seinem 80. Geburtstag stirbt – noch eine Berühmtheit ist. Doch als Intellektueller hat er längst aufgehört, im eigentlichen Sinne „maßgeblich“ zu sein.
Denn die nachfolgende Philosophen-Generation ist keineswegs geneigt, sein kritisches Werk in seinem Sinne fortzuführen. Im Gegenteil: In den nächsten Jahrzehnten positionieren sich philosophische Autoren insbesondere dadurch, indem sie sein kritisches Werk in wesentlichen Aspekten verwerfen und behaupten, dadurch darüber grundlegend „hinausgehen“ zu können.
Dass es keine Kontinuität zwischen dem kritischen Werk und diesen darüber „hinausgehenden“ Philosophien gibt, hat Kant durch seinen letzten wichtigen philosophischen Diskussions-Beitrag am 7. August 1799 noch selbst in Form einer öffentlichen Erklärung hinterlassen.
Wie es zu dieser öffentlichen Erklärung und Distanzierung gegenüber den Autoren des sich damals formierenden sogenannten „Idealismus“ kam?
Um die Motivation hinter Kants Erklärung zu verstehen, lohnt ein kurzer Blick, auf die Grundkonzeption der sogenannten „Metaphysik“, die er im Rahmen seines kritischen Werks ausarbeitet. Die besondere Kantianische Version dieser „ersten Philosophie“, die bei Aristoteles als „Wissenschaft von den ersten Prinzipien“ definiert wird, wird in den Kritiken streng an die – wie Kant es nennt – „Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung“ gebunden. Kurz gesagt, entwickelte er damit ein „metakognitives“ Konzept, welches für ihn das „Maß“ aller empirischen Dinge war. Genau diese Strategie, die Möglichkeiten insbesondere unseres Denkens – heute sagen wir eher „Kognitionen“ – zum „Maß aller empirischen Dinge“ zu machen, ist das Charakteristikum des kritischen Werks.
Gleichzeitig ist diese Begründung von Philosophie auf der Basis der Analyse von individuellen Bewusstseins- und Denkprozessen der „Stein des Anstoßes“ an dem seine „Nachfolger“ ansetzen, um Kants Vernunftkritik zu „überwinden“.
Schauen wir uns an, woran dabei insbesondere das auf Kant folgende „Idealismus-Trio“ – Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling und Georg Wilhelm Friedrich Hegel – ansetzte.

(Das idealistische „Trio“ – gemäß KI drei Gestalten im Dunklen.)
Zweistufen-Konzept: Ähnlich wie in der heutigen Kognitions-Psychologie sowie in der kognitiven Neurowissenschaft davon ausgegangen wird, dass die Realitätserfassung unseres Bewusstseins in wichtigen Aspekten auf zweierlei „Art“ typischer Prozesse gründet, definierte Kant zwei aufeinander abgestimmte aber heterogene Denkkompetenzen.
Was ist damit gemeint? – Beispielsweise schreibt Daniel Kahneman in seinem Buch „Schnelles Denken – langsames Denken“ von zweierlei „Denksystemen“. Das Konzept von „Denksystemen“ hatte er aus älteren Veröffentlichungen des Kognitions-Psychologen Keith Stanovich und dessen Team entnommen. (11) Stanovich hat in seinen Arbeiten zur Entwicklung einer Meßmethode für rationales Denken festgestellt, dass die individuelle Realitätserfassung aufgrund von Denk-Prozessen des sogenannten „autonomen Minds“ funktioniert, der durch einen „reflektierenden Mind“ überwacht wird. Der reflektierende Mind greift im Fall von Fehlern ein und ermittelt optimierte Reaktions-Alternativen. Kahneman hebt in seinem genannten internationalen Bestseller hervor, dass das autonome Denken schnell funktioniert, während das reflektierende Denken langsam erfolgt und für das Erkenntnissubjekt mit großer Anstrengung und Zeitaufwand verbunden ist.
Kant hatte in der ersten Hälfte der Vernunftkritik ein in seiner Grundstruktur mit diesem Mehrstufenkonzept der Kognitions-Psychologie übereinstimmendes Modell entwickelt und viele Details zu Teilfunktionen und Funktions-Aspekten ausgeführt. Bei ihm entspricht der „autonome Mind“ dem „Verstand“, der aufgrund von „schematisierten“ sogenannten „Kategorien“ Sinnesdaten automatisch – „spontan“ – zu Dingen unserer Erfahrung verarbeitet. Das kontrollierende – „höhere und richterliche und ganz obere“ – Erkenntnisvermögen definiert er als „Vernunft“, die zur Interpretation der Erfahrungs-Dinge „Ideen“ und „ordnende Prinzipien“ entwickelt.
Noch einmal anders formuliert: Aus Kants Sicht, entsteht unsere Erfahrungswelt grundsätzlich ausschließlich auf der Basis der „Spontaneität“ des formale Konzepte auf Sinnesdaten abarbeitenden Verstandes. Die Vernunft hat als realen „Stoff“ ausschließlich diese Erfahrung zur Verfügung und kann aufgrund ihrer eigenen Konzepte – „Ideen“ – keinerlei „objektive Erkenntnis materialer Art gewinnen“.
Immer wieder betont Kant die für eine vernünftige Welterfassung notwendige Berücksichtigung von Erfahrung und die Warnung vor einer Spekulation, die den Boden dieser empirischen Tatsachen verlässt und etwa behauptet, es gäbe außerhalb der Erfahrung existierende Realitäten oder Dinge. Oder mittels Vernunft könnte der „göttliche Bauplan“ unserer Welt und Natur gefunden werden. Die reale Basis unserer Rationalität ist für Kant die sinnlich gegebene Erfahrung. Kant schreibt in der Kritik der reinen Vernunft (12):
„So fängt denn alle menschliche Erkenntnis mit Anschauungen an, geht von da zu Begriffen, und endigt mit Ideen. Ob sie zwar in Ansehung aller dreien Elemente Erkenntnisquellen a priori hat, die beim ersten Anblick die Grenzen aller Erfahrung zu verschmähen scheinen, so überzeugt doch eine vollendete Kritik, daß alle Vernunft im spekulativen Gebrauche mit diesen Elementen niemals über das Feld möglicher Erfahrung hinaus kommen könne (…).“
Anhand dieser für Kants Metaphysik zentralen Position können wir nachvollziehen, welche grundsätzlich andere Weltanschauung seine idealistischen Nachfolger im Anschluss entwickeln.
Schauen wir dazu bei Georg Wilhelm Friedrich Hegel nach.
Beispielsweise in dessen Schrift zur Philosophie-Geschichte (13) finden wir wieder das bekannte Muster – zunächst wird Kants Kritik mit geheuchelt wirkender Hochachtung bedacht. Die wird dann rasch abgelöst von einer vollständigen, „absoluten“ in rüde Begrifflichkeit gekleidete Abkehr vom Konzept des Königsbergers. Im Einzelnen finden wir folgenden Gedankengang:
Zunächst wird Kant als Denker gewürdigt, der Hegel entscheidend beeinflußt habe, der einen großen Erkenntnisschritt „nach vorn“ getan hätte. Hegel schätzt an Kant transzendentaler Deduktion, dass er hier Verstandes-Begriffe als nicht von der Natur Abstrahiertes, sondern als Erfahrung formende Konzepte würdigt. Für Hegel erkennt Kant damit die „wirkliche Natur“ des Gedankens; dieser sei nicht etwa passiv und zieht lediglich Schlußfolgerungen, sondern sei das aktive Prinzip, das die „Inhalte des Seins“ formt.
Das ist der Teil von Kant, den Hegel als positiv zu würdigendes Moment interpretiert. – Nun kommt der Verriss mit der Behauptung, Kants große Entdeckung sei aber noch unvollständig, denn er betrachte den Gedanken, den aktiven, formenden Begriff, als bloß subjektiven Gedanken eines individuellen Bewusstseins. Dabei sei doch die Erkenntnis der spekulativen Philosophie, dass der Gedanke, der Begriff, seinen Inhalt aus sich selbst heraus erzeugt – dass die Idee alle Materie setzt – die eigentliche intellektuelle Errungenschaft der Philosophie. Hegel verwirft Kants metakognitive Definition der „Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung“ und kritisiert scharf dessen Begrifflichkeit als barbarische – bloß psychologisch und empirische – Terminologie: „Von der barbarischen Terminologie nicht zu sprechen, bleibt Kant innerhalb der psychologischen Ansicht und empirischen Manier eingeschlossen.“
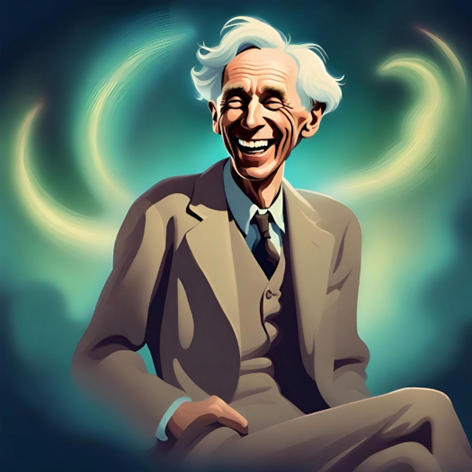
(Russell amüsiert sich über Hegels Gedankenwelt – laut KI.)
Was ist von Hegels Position zu halten, dass „die Materie von der Idee“ gesetzt sein soll? Heute erscheint Leserinnen und Leser diese „Wahrheit der spekulativen Philosophie“ wahrscheinlich vollständig absurd. Dennoch berichtet als Zeitzeuge der aus Wales stammende Bertrand Arthur William Russell, 1872 geborene Philosoph, Mathematiker, Religionskritiker, Logiker, Pazifist und Nobelpreisträger – davon, dass in seiner Jugend, hegelianischer Idealismus eine akzeptierte Philosophie war (14):
„Hegels Philosophie ist so absonderlich, dass es eigentlich nicht zu erwarten war, dass er zurechnungsfähige Menschen dazu bringen könnte, sie zu akzeptieren, aber er tat es. Er hat sie so unverständlich dargelegt, dass die Leute dachten, sie müsse tiefgründig sein (…) “
Russell gibt Hinweise, wie dieser Hegelianismus „entzaubert“ werden kann (15):
„(…) Wenn dieses Konzept klar formuliert, wird dessen Absurdität deutlich und zeigt, wie weit es sich vom gesunden Menschenverstand entfernt hat (…)“
„Paraphrasieren“ wir Hegels Konzept des „Absoluten“ in klarer Sprache, tritt dessen Absurdität tatsächlich deutlich zu Tage:
Wir und die Welt um uns herum sind nicht eigenständig existierend, sondern nur Veränderungen einer unendlichen Substanz, des Absoluten. Es gibt nur eine einzige Substanz mit unendlicher Denkkraft und unendlicher Ausdehnung. Der Weltgeist ist die einzige notwendige und auch die einzige mögliche Substanz; alles andere existiert, wirkt nicht außerhalb, sondern ist eine Veränderung des aus sich selbst schaffenden Geistes – des Absoluten. Alles ist eins und eins ist alles.
Eine andere Möglichkeit, die Bertrand Russell gefunden hat, Hegel „auf den Zahn zu fühlen“, ist es, dessen mathematische Philosophie genauer unter die Lupe zu nehmen (16):„Als ich jung war, waren die meisten Philosophielehrer an britischen und amerikanischen Universitäten Hegelianer, so dass ich, bis ich Hegel las, annahm, dass in seinem System eine gewisse Wahrheit stecken müsse; ich wurde jedoch geheilt, als ich feststellte, dass alles, was er über die Philosophie der Mathematik sagte, blanker Unsinn war.“
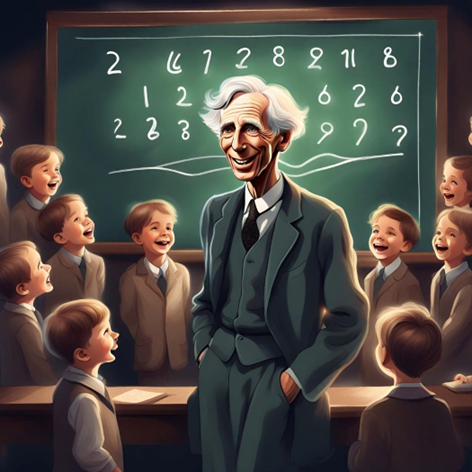
(Russell erläutert jungen Zeitgenossen die „Mathematik“ Hegels – wie es sich die KI vorstellt.)
Was ist die Motivation von Universitäts-Professoren, die esoterische, idealistische Weltanschauung eines Hegels zu akzeptieren?
Und: Dass in diesem Rahmen Konflikte mit der empirischen Realität vorprogrammiert sind, liegt auf der Hand. Wie gehen diese Philosophen damit um, wenn sie mit ihren faktenfernen Welterklärungen aufzufallen drohen?
Bertrand Russell beantwortet die Frage nach der Motivation, mit der Fixierung mancher Philosophien auf einen „intellektuellen Approach“. Dieser Approach ist auf intellektuelle Probleme und Themenstellungen ausgerichtet. Seine Vertreter setzen auf künstlerisch-kreative Methoden und legen Texte aus – arbeiten „hermeneutisch“. Sie bearbeiten Denk-Probleme, moralische Fragestellungen und analysieren Weltanschauungen und glauben auf dieser Basis aus ihrem Ohrensessel heraus, die Welt von einer höheren Warte her als „Ganzes“ zu verstehen. Methodisch zielen sie meist auf das Verständnis historischer Quellen, etwa der Bücher klassischer Denker.

(Hegel versucht sich als Astro-Physiker – so illustriert die KI sein Scheitern.)
Und wagen sie sich einmal bei Vorhersage konkreter Fakten zu weit heraus und scheitern „naturgemäß“ an der „harten Realität“, behelfen sie sich durch Vertuschungs-Tricks. Russell berichtet von Hegels publizistischem „Ausflug“ in die Astronomie (Hegels Habilitationsschrift von 1801) (17):
„Hegels System befriedigte die Instinkte der Philosophen mehr als alle seine Vorgänger. Es war so obskur, dass kein Laie hoffen konnte, es zu verstehen. Es war optimistisch, denn die Geschichte ist ein Fortschritt bei der Entfaltung der absoluten Idee. Sie zeigte, dass ein Philosoph, der in seinem Arbeitszimmer sitzt und über abstrakte Ideen nachdenkt, mehr über die reale Welt wissen kann als ein Staatsmann, ein Historiker oder ein Wissenschaftler. In diesem Zusammenhang gab es zugegebenermaßen einen unglücklichen Zwischenfall. Hegel veröffentlichte seinen Beweis, dass es genau sieben Planeten geben muss, nur eine Woche vor der Entdeckung des achten. Die Angelegenheit wurde vertuscht und eine neue, überarbeitete Ausgabe wurde eilig vorbereitet.“
„Gott bewahre uns vor unseren Freunden …“
Schließen wir mit dieser Anekdote die Betrachtung der idealistischen, „intellektualistischen“ Abweichung von Kants eher Erfahrungs-wissenschaftlichem Ansatz der Kritiken. Wie angekündigt diente dieser Einblick in die Vorstellung des „Absoluten“ von Hegel – und damit auch von Schelling und Fichte -, um zu zeigen, wie sich Kant per öffentlicher Erklärung am 7. August 1799 vom damals formierenden sogenannten „Idealismus“ – dabei stellvertretend von Fichtes „Wissenschaftslehre“ – distanzierte:
Er veröffentlichte an diesem Tag die „Erklärung in Beziehung auf Fichtes Wissenschaftslehre.“, die in „Kant’s gesammelten Schriften“, herausgegeben von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften dokumentiert wurde (18). Er erklärt direkt zu Beginn des auf zwei Seiten wiedergegebenen Textes „(…) dass ich Fichtes Wissenschaftslehre für ein gänzlich unhaltbares System halte (…)“. Er distanziert sich deutlich von der im Idealismus vertretenen Vorstellung, aus reiner Logik reale Objekte abstrahieren zu können: „(…) Denn reine Wissenschaftslehre ist nichts mehr oder weniger als bloße Logik, welche mit ihren Prinzipien nicht zum Materialien des Erkenntnisses versteigt, sondern vom Inhalte derselben als reine Logik abstrahiert, aus welcher ein reales Objekt herauszuklauben, vergebliche und daher auch nie versuchte Arbeit ist, (…)“.
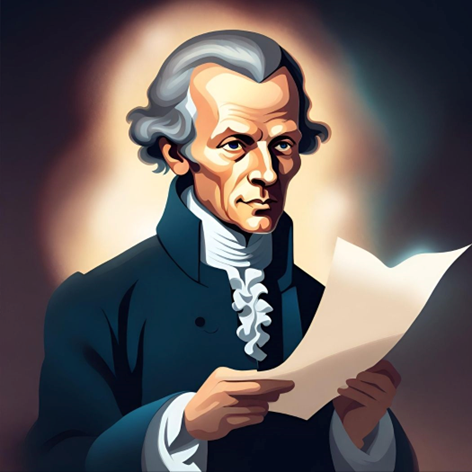
(KI symbolisiert den Augenblick: Kant gibt seine Erklärung ab.)
Empört weist Kant die Behauptung zurück, sein Werk als „bloße Einführung“ – als Propädeutikum – zu interpretieren, welche nun von der eigentlichen Philosophie Fichtes zu perfektionieren wäre:
„Hierbei muss ich noch bemerken, dass die Anmaßung, mir die Absicht unterzuschieben: Ich habe bloß eine Propädeutik zur Transzendentalphilosophie, nicht das System dieser Philosophie selbst liefern wollen, mir unbegreiflich ist. (…) “
Aus seiner Sicht bedarf seine kritische Philosophie keiner Nachbesserungen: „(…) Aber demungeachtet muss die kritische Philosophie sich durch ihre unaufhaltbare Tendenz zu Befriedigung der Vernunft in theoretischer sowohl als moralisch praktischer Absicht überzeugt fühlen, dass ihr kein Wechsel der Meinungen, keine Nachbesserungen oder ein anderes geformtes Lehrgebäude bevorstehe, sondern das System der Kritik auf einer völlig gesicherten Grundlage ruhend, auf immer befestigt und auch für alle zukünftige Zeitalter zu den höchsten Zwecken der Menschheit unentbehrlich sei.
Kant spottet über die durchsichtige, auf sein Verderben abzielende Strategie seiner Nachfolger, ihm zunächst in der Sprache des Wohlwollens zu schmeicheln. Dabei bezieht er sich auf das Sprichwort: „Gott bewahre uns nur vor unseren Freunden, vor unseren Feinden wollen wir uns selbst in Acht nehmen. Es gibt (…) Betrügerische, Hinterlistige, auf unser Verderben sinnende und dabei doch die Sprache des Wohlwollens führende (…) sogenannte Freunde, vor denen und ihren ausgelegten Schlingen man nicht genug auf seiner Hut sein kann.“

(KI-Fantasie: Kant distanziert sich von seinen „Freunden“.)
Deutlicher hätte Kant wohl kaum sagen können, dass es keine Kontinuität von seinem Werk und den Überlegungen seiner idealistischen Nachfolger gibt. Fichte, Schelling und Hegel übernehmen die Rolle von elitären Propheten, deren Prädestinations-Lehren sich vom „gesunden Menschenverstand“ Kantianischen „Zuschnitts“ verabschieden.
Copyrights der Bilder
Die Bilder wurden per Künstlicher Intelligenz mit dem Online-Grafik-Service Canva.com erstellt. Im Detail liegen den Darstellungen keine Portrait-Bilder Immanuel Kants zugrunde o.ä. Es handelt sich bei allem um freie AI-„Fantasie“.
Quellen
Hermann Cohen, Kants Theorie der Erfahrung, Berlin 1885 (Ausgabe 2)
- Friedrich Nietzsche, Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert. (1889) – Was den Deutschen abgeht – Absatz 7
- Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut Böse Vorspiel einer Philosophie der Zukunft (1886) – Abschnitt 210
- Heinrich Heine, Erstdruck unter dem Titel »De l’Allemagne depuis Luther« (Über Deutschland seit Luther) in: Revue de deux mondes (Paris), 1834, erste deutsche Ausgabe in: Der Salon, 2. Bd., Hamburg (Hoffmann und Campe)
- Immanuel Kant, Briefwechsel – Auswahl und Anmerkungen von Otto Schöndörfer, Hamburg: Meiner Verlag 1972
- Moses Mendelssohn, Morgenstunden oder Vorlesungen über das Daseyn Gottes, Berlin: Christian Friedrich Voß und Sohn 1785
- Immanuel Kant (1783), Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können, Hamburg: Meiner Verlag 1976 – Seite 8
- Ebenda
- Vergleiche die Darstellung der Geschichte der Rezeption der Kritik in: Jonathan I. Israel, Democratic Enlightenment – Philosophy, Revolution, and Human Rights 1750-1790, Oxford: Oxford University Press 2012, S. 633 – 778
- Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie; dritter Abschnitt. Neueste deutsche Philosophie – B. Kant Geschichte der Philosophie
- Manfred Kühn, Kant – Eine Biographie, München: C. H. Beck 2003
- Heinz W. Droste, Entfessele Dein bestes Denken, Hückelhoven: Pedion Verlag 2022
- Immanuel Kant (A1781/B1787), Kritik der reinen Vernunft, Hamburg: Meiner Verlag 1976) – A 702 / B 730
- s. o. in: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie
- Bertrand Russell, Unpopular Essays. London: George Allen & Unwin 1921, Seite 20 (Übersetzung)
- Ebenda
- Ebenda, Seite 23 (Übersetzung)
- Ebenda, Seite 75 (Übersetzung)
- Kant’s gesammelte Schriften. Band 12 / herausgegeben von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften – Kant’s Briefwechsel – Band III 1795 -1803 Anhang – Zweite Auflage Berlin und Leipzig: Walter de Gruyter & Co. 1922








