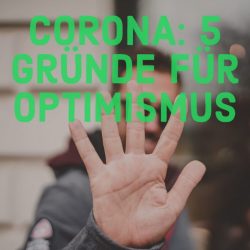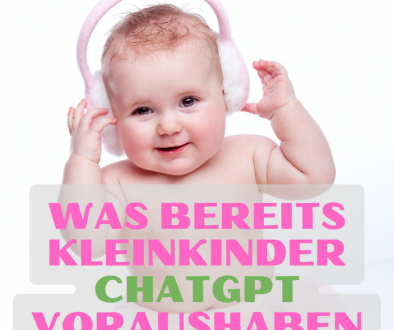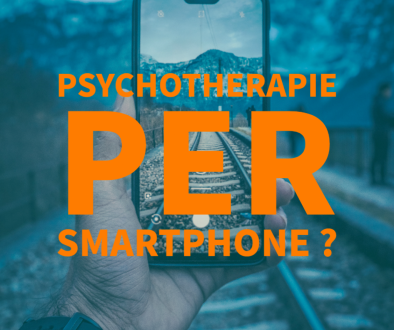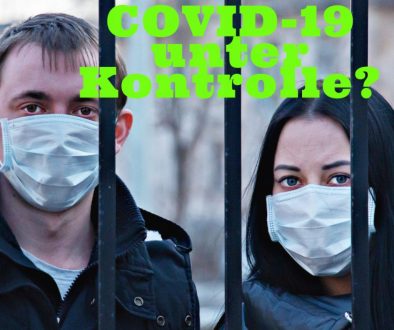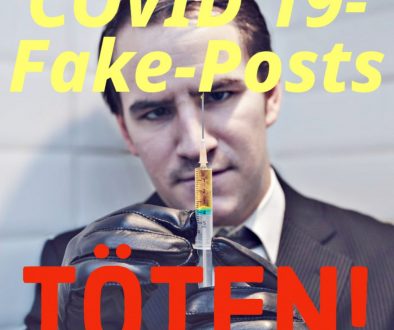Coronavirus: fünf Gründe, optimistisch zu sein
von: Ian Boyd, Universität St. Andrews (UK)
(Übersetzung des Originalbeitrags vom 24.04.2020 – Original s.u.)
Ein Großteil der Medienberichterstattung über COVID-19 konzentriert sich auf schlimme Dinge, die geschehen. Es ist sehr leicht, Menschen der Pfuscherei zu beschuldigen, wenn man im Rückblick alle Informationen überschaut und es gute Schlagzeilen macht, aber ist das richtig?
Was von außen wie ein Fiasko aussehen kann, ist oft sehr plausibel, wenn man es in Echtzeit und in der laufenden Diskussion sieht. Sich auf die unvermeidlichen Probleme zu konzentrieren, die in einer sich schnell verändernden Situation auftreten, anstatt zu versuchen, das große Ganze zu sehen, hilft nicht wirklich dabei, die Öffentlichkeit zu informieren und sie mit Fakten zu versorgen.
Beispielsweise sind viele Kommentare zu den Tests für COVID-19 mangelhaft begründet. Das Testen ist ein komplexes Thema, bei dem es ebenso sehr darum geht, wie die Tests eingesetzt und verwendet werden, wie um die Art der Tests oder die Anzahl der verfügbaren Tests. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, welche Fragen wir zu Tests stellen und wie gut die Antworten wahrscheinlich sein werden.
Tests sind entscheidend für die Lockerung der derzeitigen Maßnahmen zur sozialen Distanzierung, so dass die Verbesserung des Wissens über ihre Stärken und Schwächen im Bewusstsein der Öffentlichkeit für den Erfolg entscheidend ist. Letztlich werden wir eine Lockerung der Beschränkungen nur dann erreichen, wenn der Einzelne über die Informationen verfügt, die er benötigt, um Entscheidungen darüber zu treffen, was sicher oder unsicher ist.
Den Medien kommt bei der Vermittlung dieser wichtigen Botschaften eine entscheidende Rolle zu. Aggressive Befragungen der Regierung haben ihren Platz, aber sie sind wenig hilfreich, wenn sie zu einer Abwehrreaktion, zur Bindung von Ressourcen und zu einer allgemeinen Ablenkung von der Lösung des durch diese schreckliche Krankheit verursachten grundlegenden Problems führen. COVID-19 ist kein politisches Problem, auch wenn einige Leute es dazu machen wollen. Das Einzige, was gewinnen wird, wenn wir es politisieren, ist das Virus selbst, SARS-CoV-2.
Um ein Gegengewicht zur Negativität zu schaffen, schlage ich vor, dass wir uns auch um die positiven Aspekte kümmern müssen, damit die Menschen sehen können, was getan wurde, was funktioniert und wie die Dinge in Zukunft aussehen könnten, wenn wir auf eine zweite Welle des Virus treffen.
1. COVID-19 ist in vielen Ländern unter Kontrolle
Der Wert von R0 – die durchschnittliche Zahl der Menschen, die von jemandem mit der Krankheit infiziert sind – lag bei Ausbruch der Pandemie bei etwa 3. Jetzt liegt er in vielen Ländern und wahrscheinlich auch in Großbritannien unter 1. Das bedeutet, dass die Krankheit unter Kontrolle und im Rückgang begriffen ist. Auch wenn es noch ein langer Weg ist, um diese Krankheit unter Kontrolle zu bringen, sollten wir diese Leistung und ihre Bedeutung nicht unterschätzen.
Wäre das im Vereinigten Königreich und anderswo nicht geschehen, dann wären die gegenwärtigen Probleme mit PSA, Beatmungsgeräten und Krankenhausbetten, ganz zu schweigen vom persönlichen Leid, im Vergleich dazu verschwindend gering gewesen. Stattdessen sind Krankenhäuser dort im Großen und Ganzen innerhalb ihrer Kapazitäten arbeitsfähig, auch wenn es zu bestimmten Zeiten an verschiedenen Orten Engpässe gegeben hat.
2. Dies wurde dadurch erreicht, dass wir alle unsere Lebensweise vorübergehend aufgegeben haben
Dies mag nicht als etwas Positives erscheinen, aber angesichts der tiefen Spaltungen innerhalb der britischen Gesellschaft – die in Brexit am deutlichsten sichtbar werden – ist es bemerkenswert, Zeuge dieser Einheit des Handelns gewesen zu sein, die noch vor wenigen Monaten undenkbar gewesen wäre.
Ich glaube nicht, dass irgendein Verhaltensforscher vorhergesagt hätte, wie sehr wir alle an einem Strang gezogen haben, um diese Krankheit in den Griff zu bekommen. Der rasche Übergang zu einer Strategie der sozialen Distanzierung war ein immenser Erfolg, auch wenn es schwierig war.
Die Einhaltung der Bedingungen für soziale Distanzierung und Abschottung fand in der britischen Öffentlichkeit breite Unterstützung.
3. Wir wissen jetzt viel mehr über den Umgang mit dieser Krankheit
Bei einem Virus, von dessen Existenz wir vor fünf Monaten noch nicht wussten, wissen wir heute dank eines enormen Aufwands zur Datenerfassung hinter den Kulissen fast Molekül für Molekül. So sehr wir uns einen Impfstoff und nützliche Tests auch wünschen mögen, wir haben Methoden zur Kontrolle von COVID-19, von denen wir jetzt wissen, dass sie funktionieren können.
Wir wissen auch viel mehr über die Art der Herausforderungen, die vor uns liegen. Zum Beispiel können wir ein Wiederaufflammen der Krankheit im Winter vorhersagen. So problematisch es auch sein mag, wenn wir den Willen dazu haben, können wir COVID-19 auch ohne Impfstoff und Tests unter Kontrolle halten. Das ist keine geringe Leistung.
4. Wir haben gelernt, auf massiver, globaler Ebene gemeinsam zu handeln.
Die globale Reaktion auf das bedeutende Problem von COVID-19 war bemerkenswert. Sie hat eine Katastrophe für die Menschheit abgewendet, und sie deutet darauf hin, dass wir organisatorisch in der Lage sind, die wirklich großen Probleme der Menschen und des Planeten anzugehen.
5. Wir wissen viel mehr über unsere Verwundbarkeiten und wie wir mit ihnen umgehen können.
Die einzelnen Länder lernen durch Handeln. In Großbritannien werden wir uns weiterhin an die „neue Normalität“ anpassen und flexibel sein. Eine Änderung der Politik der sozialen Distanzierung muss erfolgen, wobei wir uns gleichzeitig auf verlässliches Wissen darüber stützen müssen, inwieweit jede Änderung dazu führen könnte, dass die Zahl R0 wieder in Richtung 1 steigt.
Kosten und Nutzen
All dies gegen die Nachteile der sozialen Distanzierung für gefährdete Menschen und die Wirtschaft abzuwägen, wird immer eine harte, moralisch begründete Entscheidung sein. Sie erfordert ein anpassungsfähiges Management – das heißt, zu lernen, was funktioniert, indem verschiedene Methoden ausprobiert werden – und Geduld. Aber es wird auch eine offene Debatte darüber erfordern, wo das moralische Gleichgewicht zwischen Kosten und Nutzen liegt.
Diese Debatte muss von dem grundlegenden Erfolg, den wir erleben, geprägt sein und wird nicht durch Schlammschlachten verstärkt. Der zunehmende Lärm der Kritik von führenden Schriftstellern und politischen Redakteuren und die Tendenz, das Schlechte gegenüber dem Guten zu betonen, scheint in diesen schwierigen Zeiten seltsamerweise im Widerspruch zu der im größeren Zusammenhang stehenden Geschichte und der richtigen moralischen Haltung zu stehen.
Ian Boyd, Professor für Biologie, Universität von St. Andrews
Dieser Artikel wird aus The Conversation unter einer Creative-Commons-Lizenz wiederveröffentlicht.
Coronavirus: five reasons to feel optimistic

Ian Boyd, University of St Andrews
Much of the media coverage of COVID-19 is focused on bad things happening. It is very easy to accuse people of bungling when you have 20-20 hindsight and it makes good headlines, but is it right?
What can look like a fiasco from the outside is often very plausible if seen in real time and in the round. Zeroing in on the inevitable problems that crop up in a fast-moving situation, rather than trying to see the bigger picture, doesn’t really help inform the public and arm them with facts.
For example, much commentary about testing for COVID-19 is poorly informed. Testing is a complex issue that is as much about how tests are deployed and used as the type of tests or how many are available. We need to be clear about what questions we are asking about testing and how good the answers are likely to be.
Testing is critical to the relaxing of current social distancing measures so improving the knowledge about its strengths and weaknesses in the mind of the public is critical to success. In the end, we will only make relaxation of restrictions work if individuals have the information they need to make decisions about what is safe or unsafe.
The media has a critical role to deliver these important messages. Aggressive interrogation of government has its place, but it is unhelpful when it results in a defensive response, the tying up of resources and general distraction from solving the fundamental problem caused by this terrible disease. COVID-19 is not a political problem even if some people want to make it so. The only thing that will win if we politicise it is the virus itself, SARS-CoV-2.
To counterbalance negativity, I suggest we also need to look towards the positives so that people can see what has been done, what is working and how things might look in the future if we encounter a second wave of the virus.
1. COVID-19 is under control in many countries
The value of R0 – the average number of people infected by someone with the disease – was about 3 when the pandemic kicked off. Now it is down below 1 in many countries and probably also in the UK. This means the disease is under control and in decline. Even if there is still a long way to go to nail this disease down, we should not understate this achievement and what it means.
If that had not happened in the UK and elsewhere, then the current problems with PPE, ventilators and hospital beds, not to mention the personal suffering, would have been minuscule by comparison. Instead, our hospitals are broadly operating within capacity even if there have been pinch points in various places at particular times.
2. This has been achieved by us all abandoning our way of life temporarily
This may not seem like something that is positive, but given the deep divisions that exist within UK society – most profoundly illustrated throughout Brexit – it is remarkable to have witnessed this unity of action that would have been unthinkable just a few months ago.
I do not think any behavioural scientists would have predicted just how much we have all pulled together to get on top of this disease. The rapid transition to a strategy of social distancing has been an immense success even if it has been tough going.

Shutterstock
3. We now know a lot more about how to manage this disease
For a virus we never knew existed five months ago, thanks to a huge effort to collect data behind the scenes, we now know it almost molecule by molecule. However much we may wish for a vaccine and useful tests, we have methods to control COVID-19 that we now know can work.
We also know a lot more about the kind of challenges there are ahead. For example, we can predict a winter resurgence of disease. Troublesome though it may be, we can, if we have the will to do so, keep COVID-19 under control even without a vaccine and testing. That is no small achievement.
4. We have learned how to act in unison at a massive, global scale
The global response to the significant problem of COVID-19 has been remarkable. It has averted a disaster for humanity and it suggests we do have the organisational ability to tackle the really big problems facing people and the planet.
5. We know a lot more about our vulnerabilities and how to manage them
Individual countries are learning by doing. In the UK, we will continue to adapt and flex to the “new normal”. Modification of the social distancing policy needs to happen while also being informed by reliable knowledge about how much any change might tend to push the R0 figure back up towards 1.
Costs and benefits
Balancing all this against the disadvantages of social distancing for vulnerable people and the economy will always be a hard, morally based choice. It will involve adaptive management – learning about what works by experimenting with different methods – and patience. But it will also need to involve open debate about where the moral balance lies between costs and benefits.
This debate needs to be informed by the fundamental success we are experiencing and will not be enhanced by mudslinging. The rising ambient noise of criticism from leader writers and political editors, and the tendency to emphasise the bad over the good, seems strangely at odds with the story lying in the bigger picture and the correct moral posture in these challenging times.![]()
Ian Boyd, Professor of Biology, University of St Andrews
This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.